Full Document
Deutsche Mechaniker-Zeitung., 15.06.1912, Heft 12, S. 121-128
Das Malteserkreuz in seiner Anwendung bei den Kinematographenapparaten
Bei den Kinematographenapparaten wird bekanntlich ein aus Zelluloid bestehendes Band - der sogenannte Film - mit grosser Geschwindigkeit von einer Vorratstrommel abgewickelt und durch das Werk hindurchgeführt. An einer Stelle, dem sogenannten Bildfenster, muss das Band für einen sehr kurzen Zeitraum stillstehen, um dann möglichst rasch weggezogen zu werden. Besonders bei den Vorführungsapparaten soll die Zeit des Stillstandes im Verhältnis zu der für das Wegziehen notwendigen Zeit sehr kurz sein. Da nun in der Sekunde mindestens 12 Bilder, zuweilen aber auch bis zu 20 und mehr Bilder vorgeführt werden und, wenn möglich, die Zeit des Stillstandes mindestens doppelt so gross sein soll als die Zeit, während welcher das Bildband im Bildfenster in Bewegung ist, so folgt hieraus, dass für den Bilderwechsel jedesmal höchstens 1/36 Sekunde, zuweilen aber auch nur 1/100 Sekunde zur Verfügung steht. Wenn nun auch die Masse des der absatzweisen Bewegung unterliegenden Filmteiles sehr klein und der Weg jedesmal nur etwa 19 mm ist, so sind die Kräfte, welche an dem Bildband wirksam werden, gleichwohl recht gross. Berücksichtigt man nun, dass der Film nur 0,1 mm dick ist und wenigstens der Positivfilm immer und immer wieder auf seinen Wanderungen durch die Kinotheater vorgeführt wird, so erkennt man, dass der Konstrukteur den Hauptwert darauf legen muss, den die absatzweise Förderung des Films im Bildfenster bewirkenden Teil des Apparates möglichst sorgfältig auszubilden.
Aber nicht nur die Schonung des Fils [Films] ist hier massgebend, auch die desjenigen Teiles des Werkes, der das Bild ruckweise bewegt, kommt in Betracht. Hier ist der Apparat einer sehr starken Abnutzung unterworfen. Wird diese nun aber nicht in engen Grenzen gehalten, so bekommen die einzelnen Teile gegeneinander Spiel. In diesem Falle steht der Film nicht absolut fest im Fenster und das Bild auf dem Projektionsschirm zeigt bei der angewandten starken Vergrösserung eine unerträgliche Unruhe.
Die Bewegung des Bildbandes erfolgt im allgemeinen so, dass es durch eine stetig gedrehte Vorwickelwalze, welche mit Stiften in die Randlöcher des Bandes eingreift, dem Bildfenster zugeführt wird, aber vor diesem stets eine freie Schleife bildet. Durch das hinter dem Bildfenster befindliche, die absatzweise Bewegung des Bandes im Bildfenster ausführende Glied wird nun jedesmal in verhältnismässig sehr kurzer Zeit ein der Höhe eines Filmbildes entsprechendes Stück dieser Schleife weggenommen. Solange das Bild im Fenster dann stillsteht, wird die Schleife durch die Vorwickeltrommel wieder ergänzt.
Während nun als absatzweise arbeitendes Glied bei den Aufnahmeapparaten ein geradlinig hin und her bewegter, mit Zähnen in die Randlöcher des Films fassender Greifer noch sehr viel benutzt wird, kommt für die grossen Vorführungsapparate fast nur eine am Umfang mit Stiften versehene Walze in Frage, deren absatzweise Drehung durch ein Zwischengetriebe aus der stetigen Drehung eines Gliedes des Werkes abgeleitet wird. In weitaus den meisten Fällen dient als Zwischengetriebe ein Einzahnradgetriebe mit einer Sperrung für die zwischen zwei Eingriffen des Einzahnes liegende Zeit, das wegen der Form seines einen Teiles allgemein die Bezeichnung Maltesergesperre trägt. Dass der Greifer bei den Aufnahmeapparaten vorteilhaft Anwendung finden kann, hat vornehmlich seinen Grund darin, dass bei diesen, dank der hohen Empfindlichkeit der Negativfilms, ein verhältnismässig grösserer Teil der auf einen vollen Umlauf kommenden Zeit zur Fortschaltung benutzt werden kann, als bei den Vorführungsapparaten. Während bei der Aufnahme die Dauer der Belichtung zur Erlangung scharfer Bilder soweit als möglich herabgedrückt werden muss, muss die Dauer des freien Lichtdurchtrittes beim Vorführungsapparat zur Erzielung flimmerfreier heller Bilder möglichst gross sein; darum der verhältnismässig langsam arbeitende Greifer dort und das rascher arbeitende Maltesergesperre hier.
Es gibt nun neben diesem Gesperre noch eine Reihe von absatzweise fördernden Fortschaltvorrichtungen für Kinematographen. Von diesen ist der Schläger und die Lückenwalze (auch Nocken) von einiger Bedeutung. Bei dem Schlager trifft ein Exzenter zwischen dem Bildfenster und der stetig gedrehten Nachwickeltrommel gegen das Bildband und reisst dieses, die vor dem Bildfenster gebildete Filmschleife verkürzend, ruckweise durch das Bildfenster. Auf die Bandlöcher kommt hierbei an der Nachwickeltrommel eine grosse, ruckweise auftretende Kraft, welche das Band leicht beschädigt. Bei der Lückenwalze oder dem Nocken ist eine Walze an ihrem Umfang mit 2 gegen die Ränder des Films sich anlegenden elastischen Belegen von der Länge der Bildhöhe versehen. Diese Belege fassen beim stetigen Umlaufen der Lückenwalze den Film zwischen sich und einer losen Gegendruckrolle und nehmen ihn ruckweise mit, was gleichfalls leicht zur Beschädigung der Films führt. Allerdings haben diese beiden Konstruktionen den grossen Vorzug der einfachen und daher billigen Herstellung. Aber bei Dauerbetrieben fällt er dem grösseren Nachteil der erhöhten Abnutzung des Bandes gegenüber weniger ins Gewicht.
Bei der Bedeutung, welche das Maltesergesperre sonach für die Kinotechnik hat, dürfte es sich lohnen, im folgenden die bei ihm auftretenden Geschwindigkeitsverhältnisse und ihren Einfluss auf die Beanspruchung des Bandes näher zu erörtern.
Das Maltesergesperre (Fig. 1) besteht bekanntlich aus 2 Teilen, dem Einzahnrad P und der Schlitzscheibe Q; mit dieser ist auf gleicher Achse gekuppelt das Stiftrad, welches mit den an seinem Umfang befindlichen Stiften in die am Rande des Films angebrachten Fortschaltlöcher eingreift. An der Schlitzscheibe finden sich die Schlitze C, in welche der Einzahn Z auf einem Teil seiner Bahn eingreift. Während der übrigen Zeit ist die Schlitzscheibe und mit ihr das Stiftrad und das Bildband gegen Drehung dadurch gesichert, dass die an der Schlitzscheibe befindlichen Bogenstücke D an dem Umfang eines mit dem Einzahnrad konachsialen Kranzes anliegen. Eine in diesem vorhandene Aussparung F gestattet während der Drehung der Schlitzscheibe den Vorbeigang der zwischen den Bogenstücken D liegenden vorspringenden Spitzen.
Die Schlitze verlaufen meistens gegen den Mittelpunkt der Schlitzscheibe Q; die folgenden Ableitungen beziehen sich auf diesen Fall.
Für die Form der Bewegung der Schlitzscheibe sind folgende Grössen massgebend [nebenstehende Buchstaben oder Zahlen sind Indizes]:
der Bogen, den der Einzahn während seines Eingriffes mit der Schlitzschelbe beschreibt (2 A),
der diesem Bogen entsprechende Bogen der Schlitzscheibe, also der Winkel, den zwei aufeinanderfolgende Schlitze bilden (2 B),
der Winkel, den ein jeder Schlitz bei Beginn des Eingriffes des Einzahnes mit dem Radius des Einzahnes an jener Stelle bildet (g [gamma]).
Es seien ferner (Fig. 2):
R1 der Radius der Schlitzscheibe,
R2 der Radius der Bahn des Einzahnes,
C der Abstand der Mittelpunkte des Einzahnrades P und der Schlitzscheibe Q,
a [alpha] der Winkel zwischen C und dem Radius nach dem Einzahn für eine jede beliebige Stellung,
b [beta] der Winkel zwischen C und dem vom Einzahn ergriffenen Schlitz für den Winkel a [alpha],
E1, E2, E3 3 verschiedene Stellungen des Einzahnes,
h das Lot von der Eintrittsstelle E1 des Einzahnes in den Schlitz auf die Mittellinie beider Kreise und ha das Lot für die beliebige Stellung E2, zu der die Winkel "a" [alpha] und "b" [beta] gehören,
y"a" der Abstand des Fusspunktes des Lotes h"a" von der Mitte der Schlitzscheibe Q.
Nach dem auf schiefwinklige Dreiecke angewendeten Pythagoräischen Lehrsatz ist [V^ = Zeichen für "Wurzel"; "g" gamma]
e = V^(R1² + R2² - 2 R1 R2 cos "g"); ferner gilt
tg "b" = h"a"/(c-y"a") = R2 sin "a"/(c - R2 cos "a"). Daraus folgt:
tg "b" = sin "a"/(V^(R1²/R2² - 2 R1 cos "g"/R2 +1 - cos "a") = sin "a"/(S cos "a")
wenn gesetzt wird S = V^(R1²/R2² - 2 R1 cos "g"/R2 +1)
Um den Verlauf der Werte zu ermitteln, die "b" während des Eingriffes des Einzahnrades zu aufeinanderfolgenden Zeiten einnimmt, genügt es, die Beziehungen zwischen "b" und "a" zu ermitteln; denn die Bewegung des Einzahnes erfolgt proportional der Zeit, es ist also "a" = M t, wo M ein später weiter zu betrachtender Faktor ist. Wir bilden deshalb das erste und zweite Differential von "b" nach "a" und erhalten so Werte, welche zwar nicht die Winkelgeschwindigkeit bezw. Winkelbeschleunigung der Schlitzscheibe selbst sind, wohl aber diesen proportional sind. Da der Winkel "b" umgekehrt der Drehung im Winkel "a" läuft, so ist d"b" bei positivem d"a" negativ zu nehmen.
Bekanntlich ist d arc tg "y" = 1/(1+ "y"²) d"y". ["y" ist phi]
Hieraus ergibt sich für den vorliegenden Fall:
d"b" = ((S cos "a" - 1)/ S² - 2S cos "a" -1)) d"a
d²"b" = (S (1-S²) sin "a"/ 57.3°(S² - 2S cos "a" + 1)²) d"a"²
Um nun zahlenmässige Werte von d"b" und d²"b" aufstellen zu können, ist es erforderlich, für die Winkel A, B und "g" bestimmte Annahmen zu machen.
Der einfachste Fall ist, dass a) A = B = 45° ist. Dann muss "g" = 90 und R1 = R2 sein. Die Schlitzscheibe hat 4 Schlitze; das Einzahnrad steht auf 1/4 seines Umlaufes mit der Schlitzscheibe in Eingriff, S= V^2 oder = 1,414. Es kann ferner sein b) A = B = 36°, "g" = 108°, R1 = R2. Die Schlitzscheibe hat 5 Schlitze, das Einzahnrad steht auf 1/5 seiner Bahn in Eingriff mit einem Schlitz, S = 1,49. Hat c) die Scheibe 6 Schlitze, so gilt, wenn wiederum R1 = R2 sein soll: A = B = 30°, r = 120°, S = V^3 = 1,732. Wenn d) 9 Schlitze vorhanden sind, so ist für R1 = R2, A = B = 20°, r = 140°, S = 1,8794. Von den Fällen, in denen R1 nicht gleich R2 ist, sei e) nur der betrachtet, in dem "g" = 90°, A - 60°, B = 30°. Dann wird R1 = R2V^3 und S = 2.
Die Tabelle Ia und b gibt die Werte von d"b" und d²"b" fortschreitend um je 1/10 des Bogens A. Sie zeigt also die Verteilung über den Bogen A hin. Für das sich daran anschliessende Stück, welches der zweiten Hälfte des Eingriffes des Einzahnrades entspricht, gelten die gleichen Werte, wenn man nur die Tabelle von unten nach oben hin liest. Denn da die Schlitze nach dem Mittelpunkte hin verlaufen, so ist die ganze Bewegung im Bogen 3A symmetrisch um ihr zeitliches Mittel.
.um - Tabelle Ia
R1 = R2 a) 4 Schlitze "g" = 90°, A = B = 45° b) 5 Schlitze "g" = 108° A = B = 36° c) 6 Schlitze "g" = 120° A = B = 30° d) 9 Schlitze "g" = 140° A = B = 20°
R1 = 2 R2 e) 6 Schlitze "g" = 90° A = 60°, B = 30°
"a"/A a) b) c) d) e) d"b" = 1,0 0,000 0,309 0,500 0,766 0,000 0,9 0,090 0,414 0,597 0,822 0,066 0,8 0,202 0,534 0,696 0,877 0,146 0,7 0,351 0,674 0,798 0,929 0,240 0,6 0,542 0,828 0,916 0,978 0,350 0,5 0,790 1,000 1,030 1,025 0,477 0,4 1,111 1,172 1,145 1,062 0,614 0,3 1,504 1,340 1,235 1,095 0,755 0,2 1,918 1,485 1,298 1,115 0,879 0,1 2,270 1,590 1,342 1,133 0,967 0,0 2,410 1,618 1,365 1,136 1,000
Tabelle Ib d²"b
1,0 1,00 1,54 1,73 1,63 0,578 0,9 1,28 1,79 1,88 1,60 0,690 0,8 1,64 2,12 2,01 1,56 0,825 0,7 2,14 2,34 2,11 1,47 0,980 0,6 2,78 2,59 2,14 1,36 1,125 0,5 3,59 2,78 2,08 1,20 1,290 0,4 4,54 2,78 1,92 1,01 1,425 0,3 5,29 2,54 1,61 0,79 1,290 0,2 5,14 1,97 1,17 0,54 1,060 0,1 3,41 1,09 0,61 0,14 0,605 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 .um +
In allen Fällen ist die Geschwindigkeit der Schlitzscheibe am grössten und die Beschleunigung am kleinsten, wenn der Einzahn die Hälfte seiner Bahn durchlaufen hat, also für "a"/A = 0. Die Geschwindigkeit ist stets am kleinsten zu Beginn der Bewegung, also für "a"/A = 1. Im ersten und letzten Falle - a) und e) - beginnt und endet die Bewegung der Schlitzscheibe mit der Geschwindigkeit 0, da in diesen Fällen der Einzahn in den zu ihm senkrecht stehenden Schlitz eintritt. In den übrigen Fällen setzt die Bewegung mit Geschwindigkeiten ein, welche um so grösser sind, je kleiner die Bogen A und B sind.
Man arbeitet bei allen Fortschaltvorrichtungen im allgemeinen darauf hinaus, die dem Bogen 2A entsprechende Dunkelpause möglichst klein zu machen im Verhältnis zur Zeit, während welcher das Bild stillsteht; letztgenannte Zeit entspricht dem Bogen 360° - 2 A. Wir wollen die vorstehenden Beispiele nun unter der Voraussetzung betrachten, dass die Winkelgeschwindigkeiten der Einzahnräder in allen Füllen gleich, also die Dunkelpausen verschieden gross seien, und zwar erhalten wir dann, wenn die Zeit eines vollen Einzahnumlaufes T ist, für die Dunkelpausen in den Fällen a bis d die Werte 1/4 T, 1/5 T, 1/6 T bezw. 1/9 T. Die Werte der Winkelgeschwindigkeiten von "a" sind gegeben durch d"a"/dt = const für alle vier Fälle. Damit aber trotz der verschiedenen Bogen 2 B, um welche die Stifträder während jedes Einzahneingriffes gedreht werden, die Bildbänder jedesmal um gleiche Längen geschaltet werden, müssen die Durchmesser der Stifträder sich umgekehrt verhalten wie die Bogen 2 B. Man erhält mithin die Werte der Geschwindigkeiten bezw. der Beschleunigungen der Bildbänder, indem man in den Fällen a bis d die Werte von d"b" und d²"b" multipliziert mit 1 bezw. 45/36, 45/30, 45/20. Die so gewonnenen Zahlen sind in Tab. II und III zusammengestellt.
Man erkennt aus ihnen, dass die Geschwindigkeiten des Bildbandes im Mittel (1) zwar bei dem Rad mit 5, 6 und 9 Schlitzen wesentlich grösser sind als bei dem Rad mit nur 4 Schlitzen, dass aber dies Maximum der Bandgeschwindigkeit nur bei dem Rad mit 9 Schlitzen das Maximum der Bandgeschwindigkeit des Rades mit 4 Schlitzen übersteigt. Ganz anders liegen die Verhältnisse für die Bandbeschleunigungen. Hier kommen wirklich grosse Werte nur bei dem Rad mit 4 Schlitzen vor, während die Maxima wie auch die Mittelwerte für die 3 anderen Räder wesentlich kleiner sind.
(1) Bei der Mittelbildung waren die Werte von d"b" bezw. d²"b" für die beiden Endglieder "a"/A = 1,0 und 0,0 natürlich nur mit halbem Gewicht einzusetzen.
.um - Tabelle II. a) 4 Schlitze 1 d"b
b) 6 Schlitze 46/36 d"b
c) 6 Schlitze 45/80 d"b
d) 9 Schlitze 46/90 d"b
"a"/A a) b) c) d) 1,0 0,000 0,386 0,750 1,724 0,9 0,090 0,518 0,896 1,852 0,3 0,202 0,667 1,044 1,973 0,7 0,351 0,842 1,196 2,090 0,6 0,542 1,035 1,373 2,200 0,5 0,790 1,250 1,545 2,308 0,4 1,111 1,464 1,717 2,390 0,3 1,504 1,674 1,853 2,465 0,2 1,918 1,856 1,948 2,510 0,1 2,270 1,990 2,016 2,550 0,0 2,410 2,023 2,047 2,558 Mittel: 0,798 1,250 1,499 2,238
Tabelle III. a) 4 Schlitze 1 d²"b
b) 6 Schlitze 46/36 d²"b
c) 6 Schlitze 45/30 d²"b
d) 9 Schlitze 45/20 d²"b
"a"/A a) b) c) d) 1,0 1,00 1,94 2,59 3,67 0,9 1,28 2,24 2,82 3,60 0,8 1,64 2,65 3,02 3,51 0,7 2,14 2,92 3,17 3,31 0,6 2,78 3,24 3,Z1 3,04 0,5 3,59 3,48 3,12 2,70 0,4 4,54 3,48 2,88 2,27 0,4 5,29 3,17 2,42 1,79 0,2 5,14 2,46 1,76 1,22 0,1 3,41 1,36 0,92 0,32 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel: 3,03 2,60 2,46 2,40 .um +
Während der schrittweisen Fortschaltung hat die in den Löchern des Bandes angreifende Kraft Widerstände verschiedener Art zu überwinden: einmal die Reibung den Bildbandes im Bildfenster und gegebenenfalls an einer zwischen diesem und der Bandschleife liegenden Rolle; zum anderen die Steifigkeit des Bandes, welche dem Ausrecken der Schleife entgegenwirkt. Ausserdem aber muss der Trägheitswiderstand in der Masse des Bandes überwunden werden, welcher die hohe Geschwindigkeit des Stiftrades erteilt wird. Für die Überwindung dieses Trägheitswiderstandes kommt nur die Beschleunigung in Betracht, denn bei einer Bewegung von gleichbleibender Geschwindigkeit, also bei beschleunigungsloser Bewegung, tritt ein Trägheitswiderstand nicht auf. Diese Widerstandszelle lässt sich aber andererseits nicht durch gute Bauweise des Apparates beseitigen, während die reinen Reibungswiderstände sich in einem gut gebauten und gut im Stande gehaltenen Werk sehr herabdrücken lassen.
Man erkennt hieraus, dass bei zweckmässigem Bau des Maltesergesperres schrittweise Fortschaltungen mit zur Dauer des Bildstillstandes kurzer Dunkelpause erreicht werden können, ohne dass eine Erhöhung der Abnutzung des Bildbandes gegenüber Apparaten mit verhältnismässig grosser Dunkelpause zu erwarten ist. Er ist hierbei noch zu berücksichtigen, dass unter übrigens gleichen Umständen die durch die Reibung im Gesperre selbst erzeugten, der Drehbewegung nicht zugute kommenden Drucke auf den Einzahn und die Schlitze sowie auf die Achsen des Einzahnrades und der Schlitzscheibe um so geringer sind, je kleiner die Bogen A und B sind. Es heisst dies, dass durch Verminderung dieser Reibungen die Abnutzung des Gesperres selbst vermindert wird.
Man hat es in der Hand, die Geschwindigkeit des Malteserkreuzes bei gegebenen Bogen A und B dadurch zu verändern, dass man die Schlitze nicht nach der Mitte der Schlitzscheibe, sondern schräg verlaufen lässt und zwar so, dass der Schlitz beim Eintritt des Einzahnes tangential zu dessen Bahn liegt, beim Austritt diese aber unter einem Winkel schneidet, der etwa 60° sein mag (Fig. 3) (A. Ch. Grosmangin, Französ. Pat. 383200.) Man erreicht dadurch, dass das Maximum der Geschwindigkeit nicht bereits in der Mitte der Eingriffsdauer des Einzahnes erreicht wird, sondern erst später. Die Beschleunigungen werden dadurch geringer und dafür die Verzögerungen im zweiten kürzeren Teil der Fortschaltperiode bedeutend grösser. Es mag bei dieser Anordnung, deren Diagramm Fig. 4 für eine Scheibe mit 6 Schlitzen, bei der trotzdem die Radien der Schlitzscheibe und der Einzahnbahn gleich sind, zeigt, wohl eine etwas günstigere Beanspruchung des Bildbandes sich erzielen lassen. Das Diagramm stellt die Änderung dar in dem Verlauf des Winkels "b", die die Schrägstellung der Schlitze bewirkt. Die Kurve 1 gibt die Werte der Winkel "b" in ihrer Abhängigkeit von "a" für ein Gesperre folgender Bauart:
A = 46°, B = 30°, "g" = 105°, R1 = 1,4142 R2, S = 1,9315.
Die 6 Schlitze sind nach dem Mittelpunkt der Schlitzscheibe gerichtet. Kurve 2 gibt die "b"-Werte für dieselbe Scheibe mit der Abänderung, dass die Schlitze um 15° schräg gestellt sind. Sie verlaufen dann beim Eingriff des Einzahnes wieder tangential zu dessen Bahn. Während Kurve 1 symmetrisch zu den beiden Geraden "a" = 0,5 A und "b" = 0,5 B verläuft, wird bei Kurve 2 der Wert "b" = 0,5 B erst für "a" = 0,58 A erreicht. Die im zweiten Teil der Kurve eintretenden Verzögerungen der Bewegung der Stiftscheibe sind grösser als die in dem ersten Teile auftretenden Beschleunigungen. Die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen des Bildbandes sind somit während der Periode der Bewegung mit wachsender Geschwindigkeit kleiner und während der Periode der abnehmenden Geschwindigkeit grösser als bei Kurve 1. Es wird hierdurch zweifellos eine geringere Abnutzung des Bildbandes erzielt, und es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass auf diesem Wege günstigere Formen des Maltesergesperres gefunden werden können, als sie bis jetzt in Anwendung sind.
Bei den allgemein gebräuchlichen Maltesergesperren kommt auf jeden Umlauf des Einzahnes eine Schaltung des Kreuzes. Doch kommen auch Getriebe vor, welche auf der Schaltscheibe zwei Zähne und statt des Kreuzes einen Stern mit einer grossen Zahl von Schlitzen und Sperrbogen haben. Umgekehrt hat man aber auch schon vorgeschlagen, den Einzahn nicht bei jedem Umlauf, sondern nur jedesmal nach mehreren seiner Umlaufe mit dem Kreuz in Eingriff zu bringen. Angenommen, ein gewöhnliches Einzahnrad laufe mit M Umdrehungen in der Sekunde; die Zeitdauer jeder Schaltung des Kreuzes sei t, die Zeit vom Beginn einer Schaltung bis m dem der nächsten sei T. Dann ist die Dunkelpause U gegeben durch U = t/T. Lässt man den Einzahn nun mit m x M Umdrehungen laufen, aber nur bei jedem m-ten Umlauf in derselben Weise wie früher mit dem Kreuz in Eingriff kommen, so bleibt zwar die Zeit zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Schaltungen dieselbe, jede einzelne Schaltung läuft aber während der Zelt t/m ab und die Dunkelpause U' ist nunmehr gegeben durch U' = t/(m x T). Die nutzbare Zeit ist mithin von (T'-t)/T auf (T'-t/m)/T gewachsen. Da man ohnedies meistens einen Teil der nutzbaren Zeit zur Vermeidung des Flimmerns dadurch zu opfern gezwungen ist, dass man, während das Bild steht, eine oder mehrere ganz kurze Abdeckungen einschiebt, so ist jeder Gewinn an nutzbarer Zeit von grosser Bedeutung. Allerdings wird er hier erkauft um den Nachteil, dass die Bandgeschwindigkeiten entsprechend erhöht werden, also die Filmabnutzung auch.
Bei einer von C. Buderus - Hannover angegebenen Konstruktion soll das Einzahnrad durch eine Kulisse in der Längsrichtung seiner Drehachse verschoben werden, und zwar etwa derart, dass es bei 4 Umläufen nur während eines Umlaufes so gegen das Kreuz vorgeschoben ist, dass es mit diesem in Eingriff kommen kann; während der folgenden 3 Umläufe ist es zurückgezogen und läuft blind (D.R.P. 196451). Einfacher erscheint eine von Max Straube, Dresden-A., angegebene Konstruktion, bei der statt eines Maltesergesperres deren zwei und zwar in Hintereinanderschaltung benutzt werden (Photogr. Industrie 1912. S. 88 nach Gebrauchsmuster 481 599). Auf der Achse des ersten Kreuzes sitzt ein zweiter Einzahn, der in ein zweites Kreuz eingreift, auf dessen Achse die Stiftwalze für den Film sitzt. Hat das erste Kreuz m Schlitze, so kommt nur auf jede m-te Umdrehung des ersten Einzahnes eine Schaltung des zweiten Kreuzes. Hier wird nun noch die Form der Bewegung des zweiten Kreuzes gegenüber den gebräuchlichen Apparaten geändert. Denn die Winkelgeschwindigkeit des zweiten Einzahnes ist ja nicht mehr, wie sonst, gleichmässig, sondern gemäss den früheren Ausführungen im Anfang beschleunigt, gegen ihr Ende hin aber verzögert. Es treten mithin hier bedeutend grössere Bandbeschleunigungen auf, als bei der Anwendung des einfachen Kreuzes. Will man diese herabsetzen, so müssen die Schlitze eine passende Schrägstellung erhalten. Da bei dem Doppelkreuz die Zahl der Faktoren, von denen die Drehung des zweiten Kreuzes abhängt, doppelt so gross ist, als beim einfachen Maltesergesperre, so lässt sich die Bandförderung hier innerhalb sehr weiter Grenzen variieren.
Weitere Möglichkeiten, die Band-Geschwindigkeiten und -Beschleunigungen [Band-Beschleunigungen] abzuändern, sind dadurch geboten, dass man das Einzahnrad exzentrisch auf einer stetig umlaufenden Scheibe lagert und es mittels eines umlaufenden Getriebes antreibt. Es wird dann zu dem Kreuz so angeordnet, dass während des Eingriffes in dieses die Eigendrehung des Einzahnes um seine Achse und die Drehung der Einzahnradachse auf der Hauptscheibe sich in der die Weiterschaltung des Kreuzes vermittelnden Richtung addieren; oder mit anderen Worten, der Einzahn ist dann wirksam, wenn er auf seiner epizykloidalen Bahn sich im Maximum seiner Geschwindigkeit befindet (D.R.P. 222863 von Messters Projektion). Bei einem von F. B. Cannock angegebenen Getriebe ist das Einzahnrad mittels einer Gelenkstange verbunden mit einer stetig umlaufenden Kreisscheibe, deren Achse exzentrisch zu dem Einzahnrad liegt. Die Angriffspunkte der Gelenkstange liegen auf dem Einzahnrad und der Scheibe gleichweit von den Achsen entfernt, die etwa um die Hälfte des Radius so gegeneinander versetzt sind, dass sie mit der Achse des Kreuzes nahezu in einer Linie liegen, wobei die Achse des Einzahnrades zwischen den beiden anderen Achsen liegt. Hier ist die Winkelgeschwindigkeit des Einzahnes auf der dem Kreuz zugekehrten Seite seiner Bahn mehr als doppelt so gross wie auf der anderen Seite (Amerikan. Patent 745956).
Betrachtet man die Patentliteratur, so findet man, dass die Zahl der Vorschläge, das Maltesergesperre durch eine andere Art von Kulissenführung der in das Bildband eingreifenden Stiftwalze zu ersetzen, überaus gross ist. Es ist ohne weiteres einleuchtend, dass man durch die Ausgestaltung der Kulissen und ähnlicher Glieder der Geschwindigkeit und Beschleunigung des Bandes die beliebigsten Werte geben kann, während das Maltesergesperre immerhin nur innerhalb engerer Grenzen die Auswahl gestattet. Gleichwohl hat das Maltesergesperre sich siegreich behauptet. Es hat dies seinen Grund darin, dass das Maltesergesperre aus Teilen besteht, die von einfachen geometrischen Linien begrenzt werden, so dass ihre Herstellung immer noch einfacher ist, als die von komplizierten Kulissen.
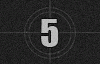
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.