Full Document
Zeitschrift für das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen., 1909, Jg. 4, Nr. 17, S. 321-323
[Zeitschrift für das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1909, ...]
Zeitschrift für das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1909, Jg. 4, Nr. 17, S. 321-323
Von Carl Cranz.
Vermischte ballistische Notizen.
V. Über einen ballistischen Kinematographen.
Mit dem gewöhnlichen Kinematographen werden von einem bewegten Gegenstand meistens etwa 16 Aufnahmen in der Sekunde, in der Grosse 2,5 x 1.9 cm erzeugt. Die Bilderzahl lässt sich auf ungefähr 60 pro Sekunde und durch besondere Vorrichtungen vielleicht auf 250 oder 300 steigern. Auch wenn letzteres erreicht ist, wird dieser Apparat für die Kinematographie von Schussvorgängen nur in solchen Fällen ausreichen, in denen es sich um kleine Geschossgeschwindigkeiten handelt. Denn in 1/300 Sekunde legt z. B. ein neueres Infanteriegeschoss, bei Verwendung der normalen Ladung und in der Nähe der Mündung, fast 3 m im Raum zurück; die einzelnen Bilder müssen also, da kontinuierliche Sonnenbeleuchtung benützt ist, unscharf ausfallen; ferner beträgt die Dauer einer Schussperiode für eine Selbstlade-Handwaffe, die Dauer eines Durchschiessungsvorgangs usf. meistens zwischen 0,1 und 0,01 Sekunde; also würden auf den in Betracht kommenden Zeitraum des Schusses nur wenige Bilder entfallen, deren Zahl und Schärfe für eine kinematographische Wiedergabe und für Messungen nicht geeignet wäre.
Im folgenden soll ein ballistischer Kinematograph beschrieben werden, der gestattet, von einem Schuss oder einem sonstigen rasch verlaufenden Bewegungsvorgang im Maximum etwa 800 Bilder, mit einem Zeitintervall von 1/5000 bis 1/5500 Sekunde zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Bildern, aufzunehmen. Da nun ein Geschoss von z. B. 500 m/sec. Geschwindigkeit in dem Zeitintervall von 1/5000 Sekunde die Strecke von 10 cm zurücklegt und da die diskontinuierliche Beleuchtung durch den elektrischen Funken zur Anwendung kommt, so wird das Geschoss auf einer Flugstrecke von 0,5 m ungefähr fünfmal scharf abgebildet werden; von einem Durchschiessungsvorgang, der 0,1 Sekunden dauert, werden 500 Aufnahmen entstehen usw.; eine kinematographische Wiedergabe der Durchschiessung oder eine Messung der Geschossgeschwindigkeit ist somit möglich. Um sogleich die Beschränkungen anzuführen, denen dieser Kinematograph unterworfen ist, so lassen sich damit nur solche Bewegungsvorgänge kinematographieren, die sich auf einem kleinen Raum und in der Nähe des Apparats abspielen; feiner werden nur Silhouettenbilder des bewegten Gegenstands erhalten.
Die Einrichtung beruht auf einer Kombination des Prinzips der Funken-Telegraphie und des bekannten Machschen Prinzips. Man denke sich den primären Kreis eines Induktionsapparats J1 (Fig. 1) durch Gleichstrom gespeist und diesen Gleichstrom etwa durch einen Wehnelt-Unterbrecher W oder einen Turbinen-Unterbrecher in regelmässiger Folge geschlossen und geöffnet, so gehen innerhalb des sekundären Kreises in der Funkenstrecke F1, der ein regulierbarer Kondensator C1 parallel geschaltet ist, regelmässig Funken über; diese Funken dienen zur Beleuchtung des bewegten Gegenstands. Es wird möglichst viel von dem Licht des Funkens durch einen Hohlspiegel gesammelt und auf einem Objektiv von kleiner Brennweite konzentriert; der Gegenstand, der zwischen Objektiv und Hohlspiegel steht, wird dadurch von hinten umleuchtet, und es entsteht vermittelst des Objektivs auf dem rasch bewegten Filmband jedesmal ein Schattenbild des Gegenstands in der Grösse der gewöhnlichen kinematographischen Bilder, so oft ein Funken übergeht. Das Filmband f ist in sich geschlossen und läuft über zwei Stahlrollen, von denen die eine R1 mit einer [Anziehvorrichtung] Anzieh- und Verstellungsvorrichtung verbunden, die andere R2 durch einen Elektromotor angetrieben ist. Um zu verhindern, dass das Filmband öfters als während einer einzigen Umdrehung des Bands belichtet werden kann, wird die Funkenreihe etwas vor dem Beginn des betreffenden Schussvorgangs eingeleitet und etwas nach dessen Beendigung wieder unterbrochen. Dies geschieht mittelst eines Pendelunterbrechers, der im Grundriss und Aufriss gezeichnet ist: Er besteht aus einem Pendel P, das durch einen Elektromagneten E zunächst festgehalten ist, und 4 parallelen und kreisförmigen Metallschienen, auf denen die Öffnungs-Schliessungs-Kontakte 12345 verschiebbar angebracht sind. Wird der Strom des Elektromagnets E unterbrochen, so setzt sich das Pendel in Bewegung und stösst gegen den Kontakt 1; dadurch wird der Strom des Elektromagnets E2 unterbrochen; der Schuss wird elektromagnetisch gelöst. Das Pendel schwingt weiter und schliesst den Kontakt 2, wodurch der Funkenstrom einsetzt. Kommt das Pendel beim Kontakt 3 an, so wird der Funkenstrom wieder unterbrochen. Tatsächlich wird dabei im Primärkreis des Induktors J1 nicht unterbrochener Gleichstrom, sondern Wechselstrom angewendet, wie dies in der drahtlosen Telegraphie üblich ist, (W Wechselstrommaschine).
Die Regulierung der Kondensatorkapazität und der Länge der Funkenstrecke auf günstigste Folge und Stärke der Funken, bei einer bestimmten Frequenzzahl und dem dazu gewählten Induktor, geschieht zunächst nach dem Gehör; weiterhin durch sukzessives Probieren, indem über die eine Stahlrolle R2 ein Bromsilberpapier-Band gelegt und darauf ein beliebiger Gegenstand abgebildet wird. (Einer der in der Funkentelegraphie gebräuchlichen Messapparate lässt sich im vorliegenden Fall nicht wohl verwenden, da es sich hier um eine sehr beschränkte Anzahl von Entladungen handelt, - 20 oder 30 oder 200 oder 500 usw., - also nicht um einen länger andauernden Funkenstrom, und da die Funkenfolge durch die Temperatur der Funkenstrecke wesentlich beeinflusst wird). Ist so durch Probieren diejenige Kombination gefunden, bei der weder die Bilder sich zum Teil überdecken, noch einzelne Bilder ausfallen, so wird diese Kombination möglichst beibehalten.
In dieser Weise wurde das Funktionieren von Selbstladewaffen, die Explosionswirkung moderner Infanteriegeschosse in feuchtem Ton und in Wassergefässen, das Zersplittern von Knochen, der Stoss elastischer Stahlkugeln, die Flügelbewegungen von Insekten usf. aufgenommen; bei der Wiedergabe auf dem Projektionsschirm gehen die betreffenden Bewegungen scheinbar sehr langsam vor sich; man ist also imstande, die Vorgänge zu analysieren. Bruchstücke solcher Aufnahmen sind zur Zeit auf der Internationalen photographischen Ausstellung in Dresden gegeben; ferner sind hier einige Teile solcher Aufnahmen abgebildet (Fig. 2 zweimal 20 Bilder über das Funktionieren einer Selbstladepistole und Fig. 3 22 Bilder über die Durchschiessung einer mit Wasser gefüllten, frei aufgehängten Gummiblase).
Weiterhin ermöglicht das Verfahren, die Translationsgeschwindigkeit eines Geschosses in der Nähe der Mündung auf kurzer und völlig freier Flugstrecke mit erheblicher Genauigkeit zu ermitteln. Zu diesem Zweck wird eine 25 cm breite Stahltrommel T, mit schmaler Schlitzblende B parallel der Trommelachse, angewendet (Fig. 4): auf dem Filmband oder dem Bromsilberpapierband, das um die Trommel gelegt und auf dieser befestigt ist, werden innerhalb des Schlitzes der Blende die Bilder in 1 cm Höhe und 25 cm Breite erzeugt. Das Geschoss fliegt an der Trommel vorbei und photographiert sich während dessen wiederholt in etwa halber Grösse (G1 G2 G3 die einzelnen Geschossbilder, Fig 4 Geschoss 98S, Fig 5 Geschoss der Zielmunition). Man misst den Horizontalabstand AB zwischen dem ersten und letzten Geschossbild und ebenso den Vertikalabstand BC; es ist dann der Tangens des Winkels ACB gleich der mittleren Geschossgeschwindigkeit auf der betreffenden Flugstrecke, falls man AB und BC in wahrer Grösse ausdrückt, (AB in Metern mittels eines mitphotographierten Glasmassstabs, BC in Sekunden mit Hilfe des Filmumfangs und der Tourenzahl der Trommel).
Was die möglichen Fehlerquellen anlangt, so ist es hier, im Gegensatz zu der Verwendung des Funkenchronographen, gleichgültig, ob die Funken innerhalb der Funkenstrecke etwas ausspringen oder nicht; gleichgültig ferner, ob die Funken genau in gleichen Zeitintervallen auftreten oder nicht, es kann sogar ein Funke ganz aussetzen; endlich ist ein Verziehen des Films beim Entwickeln, Fixieren und Trocknen ohne Belang, da mit AB das Bild des Glasmassstabs und mit BC der Filmumfang sich verzieht; notwendig ist nur, dass dieses Verziehen einerseits in der Richtung AB und andererseits in der Richtung BC gleichmässig erfolgt.
Etwaige Geschosspendelungen lassen sich hiebei kontrollieren und messen. Stellt man gegenüber der Mitte der Trommel eine Platte o. dgl. auf, die durchschossen wird, und misst die Geschwindigkeit des Geschosses vor und hinter der Platte, so ergibt sich der Geschwindigkeitsverlust, der beim Durchschiessen der Platte auftritt. Um die Geschwindigkeitsverluste durch den Luftwiderstand, Geschossformwerte usw. zu ermitteln, wird in der erwähnten Weise am Anfang und am Ende einer grösseren freien Flugstrecke die Geschwindigkeit des Geschosses gemessen; hiezu ist die Einrichtung, was den Induktor, den Kondensator, die Funkenstrecke, die Trommel und den Spiegel anlangt, doppelt angewendet (Fig. 1). Lässt man das Pendel frei, so wird bei Kontakt 1 der Schuss gelöst, bei 2 setzt der Funkenstrom ein, bei 3 wird er wieder unterbrochen, dazwischen liegen ca. 20 Funken. Das Geschoss fliegt weiter, das Pendel schwingt weiter; kommt dieses bei Kontakt 4 an, so wird von neuem der Funkenstrom eingeleitet, bei 5 wird er unterbrochen, dazwischen wiederum etwa 20 Funken. Die betreffenden Versuche sind im Gang, ebenso wird versucht, durch diskontinuierliche Entladungen in Quecksilberbogenlampen Vorderbeleuchtung grösserer Gegenstände zu erzielen. Über die bei den Messungen erhaltene Genauigkeit und über die Resultate soll später berichtet werden. Bei der Ausführung der Aufnahmen wurde der Verfasser in dankenswertester Weise durch die Herren Hauptmann Bensberg und Oberleutnant Schatte (früherem bezw. derzeitigem Assistenten im ballistischen Laboratorium) unterstützt.
Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der ballistischen Funkenphotographie interessiert, sei verwiesen auf das vortreffliche Werk von V. v. Niesiolowski-Gawin: "Ausgewählte Kapitel der Technik, mit besonderer Rücksicht auf militärische Anwendungen", 2. Aufl., Wien 1908, ferner auf die in dieser Zeitschrift erschienenen Aufsätze: 2 (1907) S. 320 und 4 (1909) S. 5, 26 52.
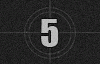
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.