Full Document
Zeitschrift des Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines., 1896, Jg. XLVIII, Nr. 25, S. 377-381
[Zeitschrift des Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines. ...]
Zeitschrift des Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines. 1896, Jg. XLVIII, Nr. 25, S. 377-381
Über die Rotations-Photographie und den Kinématographen oder "die lebende Photographie".
Vortrag gehalten in der Vollversammlung vom 25. April 1896 von k. k. Hofrath Ottomar Tolkmer, Director der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
(Schluss zu Nr. 24.) [Hier: Kinematographie]
Ich komme nunmehr zu dem zweiten Gegenstande meiner Mittheilungen, nämlich zur Erörterung der sogenannten "lebenden Photographie" und des Apparates "Kinematograph" der Gebrüder August und Louis Lumière in Lyon. - Bevor ich jedoch zur Besprechung des eigentlichen Themas gehe, will ich zum besseren Verständnisse in Kürze die Entwicklung der sogenannten "Chrono-Photographie" zur Rückerinnerung im Geiste vorbringen, weil damit auch der eminent grosse Fortschritt mit der Construction dieses Apparates. Kinématograph genannt, im Vergleich zu analogen Bestrebungen von O. Anschütz zu Lissa in Preussen mit dem Tachyskop oder Schnellseher und von Edison in Amerika mit dem Kinétographen und dem Kinétoskop, leichter ersichtlich werden wird.
Mit den Fortschritten in der Photographie und der Inaugurirung der Augenblicksphotographie anfangs der Siebzigerjahre suchten auch die Gelehrten die Lichtbildkunst ihren Studienzwecken dienstbar zu machen, um flüchtige Erscheinungen, sich schnell bewegende Gegenstände u.s.w. festzulegen, welche als Bild fixirt, nachher eingehend in ihrem Wesen studirt werden können. So hat z. B. der französische Astronom M. Janssen sich des von ihm construirten photographischen Revolvers bedient, um den Durchgang des Planeten "Venus" durch die Sonne zu beobachten.
Zur selben Zeit etwa machte zu San Francisco in Californien der Amerikaner Muybridge physiologische Studien mittelst seiner Serienaufnahmen von sich schnell bewegenden Thieren in den einzelnen Bewegungsstadien. Er liess z. B. ein Pferd auf einer Rennbahn vor einer Reibe von 12 bis 30 nebeneinander placirten Cameras, welche automatisch-elektrisch arbeiteten, im Schritt, Trab, Galopp etc. vorübergehen. Quer über die Rennbahn waren Fäden gespannt, welche zum Momentverschluss der Camera führten. Der Verschluss wurde mittelst Elektricität activirt, sobald das Pferd einen dieser Fäden berührte oder entzwei riss. Hiedurch wurde eine Camera nach der anderen zur Aufnahme geöffnet und damit 12 bis 30 aufeinanderfolgende, der Bewegung entsprechende Aufnahmen erhalten. Hiebei bewegte sich das Pferd vor einer weissen, hellerleuchteten Wand, wodurch das Bild der Aufnahme als dunkle Silhouette zum Vorschein kommt.
In Frankreich beschäftigte sich gegen Ende der Siebzigerjahre mit gleichen Arbeiten der Professor der Physiologie, Marey, welcher sich zu diesen Aufnahmen eine eigene Art pbotographischer Repetirflinte construirte, welche sich mit einer im Gewehrkolben angebrachten Trommel einmal in der Secunde in 12 Absätzen herumdreht und damit 12 Aufnahmen liefert. Aber auch Marey erzielte kein besseres Resultat als Muybridge, d. h. seine Aufnahmen waren auch nur Silhouettenbilder, jedoch mit dem Unterschiede, dass Marey zu diesen Aufnahmen die in Bewegung stehenden Personen weiss kleidete und vor einer dunklen Wand vorüberbewegen liess, so dass er damit ein umgekehrtes Resultat erhielt, nämlich helle Silhouetten auf dunklem Grunde.
Erst im Anfange der Achtzigerjahre gelang es der besonderen Geschicklichkeit und Energie des deutschen Photographen O. Anschütz, statt der Silhouetten plastisch modellirte Körper im Bilde der Aufnahme zu erhalten. Das k. preussische Kriegs-Ministerium machte sich die Vortheile dieser Errungenschaft zuerst dienstbar und liess von O. Anschütz Serienaufnahmen des Pferdes in allen Gangarten für das Reit-Lehrinstitut zu Hannover herstellen, welche ein äusserst reichhaltiges und instructives Studienmateriale für die Reitkunst lieferten.
Um sich von der Naturwahrheit der chrono-photographischen Aufnahmen von bewegten Gegenständen zu überzeugen und die betreffende Bewegungserscheinung des Gegenstandes durch Synthese, d. h. Zusammensetzung wiederzugeben, dient, wie ja zur Genüge noch erinnerlich sein wird, das Zoetrop. Man dreht die Trommel des Apparates der dargestellten Bewegung des Gegenstandes entsprechend schnell und sieht, wenn man durch einen Spalt in das Innere der Trommel blickt, die verschiedenen rasch einander folgenden Lichteindrücke verschmelzen, d. h. zu einem einzigen sich in Bewegung darstellenden Gegenstande als Bild vereinigt, wahrgenommen werden.
O. Anschütz verbesserte diese Darstellung der Synthese einer Bewegungserscheinung dadurch, dass er einen Apparat construirte, welchen er "Elektro-Tachyskop" oder "elektrischen Schnellseher" nannte. Ein solcher Apparat war 1891 in Wien in einem Parterrelocale am Parkring Nr. 2 installirt und dem Publikum gegen Entrée zugänglich gemacht. Der Effect der damit vorgeführten Serienbilder war ein geradezu verblüffender. Das Elektro-Tachyskop beruht auf demselben Principe, wie die Drehtrommel, nur dass bei dem ersteren die Bilder in einer verticalen Ebene angeordnet stehen und sich um eine horizontale Achse drehen, beim letzteren aber die Drehung der Bilder um eine verticale Achse in einer horizontalen Ebene vor sich geht. Naturwidrig an diesen sonst sehr überraschend schönen Bildern war nur der Umstand, dass der bewegte Gegenstand immer an derselben Stelle blieb, was den Sinn der Erscheinung störte, weil das Auge des Beobachters nur ein einziges und feststehendes Bild sah, auf dem die Bewegung aber als solche wohl naturgetreu, nur feststehend wahrgenommen wird.
Neuestens hat nun einen wesentlichen Fortschritt auf diesem Gebiete, u. zw. sowohl der Chrono-Photographie als der Synthese der damit erhaltenen Photogramme zur Bilddarstellung bewegter Scenen, der bekannte und als Elektrotechniker weltberühmte Amerikaner Edison zu verzeichnen, indem er von dem bewegten Gegenstande mit einem Apparate, "Kinétograph" genannt, die einzelnen Momente des bewegten Gegenstandes registrirt, mit einem zweiten Apparat aber, "Kinétoskop" genannt, die gemachten Photogramme als belebtes Bild zur Anschauung bringt und damit die präcise Darstellung der betreffenden Bewegungserscheinung wiedergibt.
In der Plenarversammlung der photographischen Gesellschaft zu Wien am 4. Februar dieses Jahres waren zwei Kinetoskope aufgestellt und in Action gewesen. Sowohl der Kinetograph als das Kinetoskop werden durch einen kleinen Elektromotor activirt und macht der erstere in der Secunde etwa 46 Aufnahmen, also in der halben Minute bei 1400 Photogramme auf einem etwa 15m langen Filmsstreifen. Davon copirt man dann auf einem biegsamen, ebenso langen Celluloidstreifen das Positiv. Dieses transparente Bildband mit den darauf nebeneinander liegenden etwa 1400 Positiv-Photogrammen wird nun in das Kinetoskop eingestellt, der Bildstreifen durch einen kleinen Elektromotor über Rollen in fortlaufende Bewegung gesetzt und der Bildstreifen von unten mit einer Glühlampe beleuchtet. Unter dem transparenten Streifen mit den Photogrammen rotirt eine ringförmige Metallscheibe mit einem einige Millimeter breiten Schlitz. Durch diesen Schlitz erblickt man in der Secunde die 46 Bilder (Photogramme) der Serienaufnahme, welche durch die rasche Folge der verschiedenen Posen den Eindruck der vollkommen continuirlichen Bewegung des einzelnen Gegenstandes, respective der Figur oder der Scenerie wiedergibt. Dabei sind die Figuren allerdings sehr klein, aber von einer packenden Plastik. Die Bewegungen der Scenerie vollziehen sich hier nicht wie bei dem Tachyskop von Anschütz ruckartig, sondern gleichmässig ineinander übergehend. Activirt wird das Kinetoskop, welches eine Art Guckkasten vorstellt, mit einem nach oben angebrachten Ocular, in welches der Beschauer hineinblickt, indem man an einen an der Vorderseite des Kastens links angebrachten Spalt ein 10 Hellerstück einwirft, wodurch sofort der Elektromotor zur Action kommt, die Glühlampe zu leuchten beginnt und der Bewegungsmechanismus mit dem endlosen Bildbande zur Thätigkeit gelangt, womit die belebte Scene recht naturgetreu dem Beobachter vorgeführt wird. Der Apparat leidet aber an Lichtschwäche der Bilder in Folge der zu grossen Zahl der Bilder, welche in der kurzen Zeit von nur einer halben Minute vor dem Auge des Beobachters vorüber eilen, die Lichteindrücke somit zu kurze Zeit auf die Netzhaut einwirken können. Ferner dass die Bilder eine geringe Tiefe besitzen und ringsum von dunklem Hintergründe umgeben sind, sowie auch darin ein grosser Mangel erblickt werden muss, dass nur immer ein Beobachter die Darstellung der Bewegungserscheinung betrachten kann.
Der höchst ingeniöse, sinnreiche Apparat der Gebrüder August und Louis Lumière, Kinématograph, welchen ich nun erläutern will und welcher den vereinten Mitgliedern des Vereines am 12. Mai, Abends 1/2 9h von dem Vertreter dieser Firma Herrn Dupont im Locale I., Krügerstrasse Nr. 2, Hochparterre, vorgeführt werden soll, ist von all' den vorgehend angeführten Mängeln frei. Der Kinématograph gestattet sowohl die Herstellung der Aufnahmen als Negativ, davon abzunehmen die Copirung des Positives; ferner ist die Zahl der Photogramme pro Secunde auf 15 reducirt. Der Apparat ermöglicht aber doch, dass dann die auf dem positiven Bildbande enthaltenen Photogramme durch Projection mittelst elektrischen Lichtes auf einem Schirm einer ganzen Versammlung von Zuschauern als lebendes Bild während der Dauer einer Minute vorgeführt werden können. Dabei ist die Tiefe, unter welcher die belebte Scene aufgenommen wird, nicht wie bei Edison's Kinétograph begrenzt, man ist daher mit dem Kinématographen im Stande, das bewegte Leben einer Strasse, eines öffentlichen Platzes aufzunehmen und als synthetisches Bild, als eine Art "lebender Photographie" dem Auditorium durch Projection in grösster und überraschender Naturtrene wiederzugeben.
Der Kinématograph kann zu dreierlei Verwendungen in Gebrauch kommen, und zwar:
Zur chrono-photographischen Aufnahme einer belebten Scenerie;
Zur Copirung des durch die chrono-photographische Aufnahme erhaltenen Negativ-Bildbandes auf ein transparentes [Gelatinband] Gelatin- und Celluloidband als Positiv, und endlich
Zur Projection des chrono-photographischen Positivbildes mittelst elektrischen Bogenlichtes auf einen transparenten Schirm, um das belebte Bild als eine "lebende Photographie" einem grossen Auditorium vorzuführen.
Der Apparat wird für die erstere und zweite Verwendungsart auf einem dreifüssigen Stativ befestigt verwendet und sieht in diesem Falle einem Touristen-Aufnahmsapparate ähnlich, wie die Fig. 7 zeigt, dagegen für die dritte Art des Gebrauchs zur Projection der positiven Photogramme und die Darstellung der "lebenden Photographie" ist der Apparat auf einem Tische placirt und mit einem elektrischen Beleuchtungsapparate in Form der Molteni-Bogenlichtlampen combinirt, wie es die Fig. 8 ersichtlich macht. Die sinnreiche innere Einrichtung des Apparates ist in der Hauptsache durch die Fig. 9 und 10 veranschaulicht.
Dieser Apparat hat nun folgende Einrichtung:
Ein lichtdicht schliessender Holzkasten A (Fig. 9) durch Thüren vorne und rückwärts zu öffnen, als der Haupttheil des Apparaten, hat vorne bei O ein Linsenobjectiv eingesetzt und am Deckel des Kastens ein schmäleres Kästchen B zur Aufnahme von zwei Metallspindeln P und Q aufgesetzt, an welche Spindeln man Rollen eines 18 m langen transparenten Gelatine- oder Celluloidbandes anstecken kann. Für den Fall der Bildprojection kommt die Bildrolle mit den positiven Photogrammen besetzt, auf die Spindel Q anzustecken; für die chrono-photographische Aufnahme dagegen kommt das lichtempfindliche Filmsband auf die Spindel P. Während im ersteren Falle der Bildstreifen durch die Öffnung H aus dem Kasten sich entfernt, wickelt sich im zweiten Falle das dem Lichte exponirt gewesene Filmsband auf der Spindel T im Kasten A auf (s. Fig. 9).
An den beiden Bändern des Bildbandes sind, wie aus der Fig. 9 zu entnehmen ist, in gleicher Höhe der einzelnen Photogramme längs des ganzen Bandes Löcher ausgeschlagen, siehe a a, b b und c c etc. Die Photogramme der Aufnahme selbst sind in je 1/15 einer Secunde mit etwa 1/5 dieser Zeit, das ist mit 1/70 Secunde Exposition hergestellt und strenge gleichartig, das heisst wenn man irgend zwei der Photogramme übereinander legt, so sind die unbewegten Partien der Scenerie exact mit einander übereinstimmend, coïncidirend, während die bewegten Partien Lagen und Stellungen aufweisen, welche der Verschiedenheit der Bewegungsaction entsprechen.
Während der Action des Apparates zur chronographischen Aufnahme wickelt sich das lichtempfindliche Filmsband von der Spindel P im Kästchen B ab, tritt durch die Öffnung bei d (s. Fig. 9) aus dem oberen Kästchen in den Kasten A, den eigentlichen Kinématographen, steigt in A senkrecht nach abwärts, durchzieht den Hals G, steigt wieder aufwärts, geht über eine Spindel bei s und wickelt sich dann auf einer dritten Spindel T wieder auf. Zur Activirung der Bewegung des [Filmsbandes] Films- oder des Bildbandes FF ist an der rückwärtigen Aussenseite des Kastens A eine Handkurbel M, durch deren Drehung mittelst einer sehr präcise gearbeiteten Zahnradübersetzuug Z Z' die Welle W W' und durch die Zahnradübersetzung p q (Fig. 10) auch die Spindel T in Bewegung gesetzt wird.
Auf der Welle WW sitzt die Auslöse-Vorrichtung k l m n mit den Stiften t t', einer Excentric g, in der Fig. 9 punktirt dargestellt, einer Trommel V mit zwei Treppen r r versehen und der verstellbaren Doppelscheibe h h'. Die letztere wird zur chrono-photographischen Aufnahme so gestellt, dass die beiden Scheiben zwischen sich 1/5 des Kreisumfanges Spalte haben, daher während dieser Zeit einer Umdrehung die Exposition des lichtempfindlichen Bandes vor sich geht. Für den Fall des Gebrauches des Apparates zur Bildprojection sind die zwei Scheiben h h' zu einander so gestellt, dass ein 1/3 des Umfanges der Scheibenfläche geschlossen, 2/3 der Fläche dagegen offen steht, während welcher Zeit die Projection des Bildes stattfindet. Durch die Umdrehung der in der Öffnungsweite entsprechend gestellten Doppelscheibe h h' ist daher die Zeitdauer der Lichtwirkung für beide Verwendungsfälle des Apparates geregelt.
Die Auslösevorrichtung selbst besteht aus einem Metallrähmchen k l m n, welches mit seinen Armen a-x in den Schleiflagern e e in verticaler Richtung verschiebbar ist, und zwar um das Mass der Entfernung der in dem Films- oder Bildbände in gleicher Höhe durchgeschlagenen Löcher a a, b b, c c etc. (s. Fig. 9). Innerhalb der Rahmenseiten l m und k n sitzt auf der Welle W W' eine Excentric g g (in der Fig. 9 punktirt angedeutet) welche bei der einmaligen Umdrehung der Welle das [Hinaufschieben] Hinauf- und Herabschieben des Rähmchens besorgt. Am Rahmenarme k sind an einem federnden Bügel r (Fig. 9 u. 10) zwei mit den Löchern des Bildbandes correspondirende Stifte t und t' vorhanden, um das nach abwärts in Bewegung stehende Band zeitweise stille zu halten (bei der Projection 2/3 einer 1/15 Secunde), zeitweise wieder in Bewegung zu setzen und herabzuziehen (1/8 von einer 1/15 Secunde). An der Trommel V sind dann correspondirend zwei Treppen r r zum Zwecke der Auslösung der Stifte t und t' aus den Löchern a a, b b etc. und Eingreifen derselben in diese Löcher nach geschehener Verschiebung um eine Lochreihe höher.
Die Functionirung des beschriebenen Mechanismus ist nun folgende: Der Rahmen k l m n der Auslösevorrichtung sei in der untersten Lage und stehe stille, die Stifte t und t' seien in die beiden in gleicher Höhe gelegenen Löcher des Films- oder Celluloidbandes versenkt, aber eine Treppe der Trommel beginnt die Stifte aus den Löchern wieder zurückzuziehen, in der Weise, dass die Stifte in dem Momente vollständig aus den Löchern des Bandes ausgelöst sind, in welchem der Rahmen seine Bewegung nach aufwärts beginnt. Diese Bewegung ist aber eine so exacte, dass sich der Rahmen genau der Entfernung der Lochreihen von einander nach der Höhe verschiebt und zwar so, dass er, in dem Augenblicke, als er in seiner höchsten Lage anlangt, stille steht: die Stifte sind genau gegenüber dem nächsten Paare der Löcher in gleicher Höhe. Die weitere Bewegung der Trommel setzt die zweite Treppe an und die Stifte t und t
greifen in diese Löcher derart ein, dass sie im darauffolgenden Herabgehen das Films- oder Bildband mitziehen, das heisst nach abwärts ziehen, wobei das Films- oder Bildband auf der Spindel P dem Zuge der Stifte t und t' nachgibt, sich abwickelt und dann entweder im Kasten A auf der Spindel T aufwickelt oder durch den Spalt H aus dem Kasten herausgeht; das erstere ist bei der Aufnahme, das letztere bei der Bildprojection der Fall. Alle diese jetzt skizzirten Bewegungen vollziehen sich in kurzer Zeit der einmaligen Umdrehung der Welle W W', das heisst in der Zeit von 1/15 einer Secunde. Eine erneuerte Umdrehung der Welle W W' besorgt eine erneuerte Exposition des lichtempfindlichen Bandes bei der Aufnahme, oder bringt ein neues Photogramm auf dem Schirme zur Projection.
Der Bewegungsmechanisnms des Apparates ist mit der grössten Präcision ausgeführt und derart angeordnet, dass das transparente Bildband, wie schon bemerkt wurde, zum Beispiel zum Zwecke der Bildprojection, während 2/3 von einer Secunde unbeweglich ist, stille steht und während des letzten Drittels von 1/15 einer Secunde hinabbewegt wird. Es ist begreiflich, dass die Lichtstrahlen der Moltenilampe, welche durch die Öffnung E an der hinteren Kastenwand (siehe Fig. 8, 9 und 10) kommen, das Bildband passiren und während der Zeit des Stillstandes auf den Schirm gelangen und daselbst die Projection des bewegten Bildes zur Folge haben. Während des letzten Drittels der 1/15 einer Secunde sind die Lichtstrahlen vollständig vom Schirme durch die Doppelscheibe h h
in der Fig. 9 punktirt dargestellt, abgehalten. Man sieht daher auf dem Schirme nur die in der Bewegung einander folgenden Photogramme projicirt.
Infolge der Unempfindlichkeit der Netzhaut des Auges bemerkt der Beobachter die Dunkelheit nicht, welche die Lichteindrücke der einzelnen Photogramme von einander trennen. Anderentheils bedarf das Licht, welches während der 2/3 von 1/15 einer Secunde Zeit durch das Bildband und das Objectiv hindurchgeht, um die Projection des Bildes zu bewerkstelligen, keiner besonderen Stärke. Der Erfolg der sich folgenden Eindrücke auf das Auge des Zusehenden ist ein vollständig befriedigender, die Wahrheit der bewegten Scenerie eine, geradezu verblüffende. Nicht verhehlen will ich jedoch, dass die Auswechslung der einzelnen Photogramme oder Bilder ein Flimmern, ein Zittern der ganzen Darstellung im Gefolge hat, was die sonst so naturgetreue und schöne Wirkung einigermassen beeinträchtigt.
Soll der Apparat zur Herstellung der chrono-photographischen Aufnahme einer belebten Scenerie als Bildband in Negativform in Verwendung kommen, so befestigt man denselben, wie schon im Vorhergehenden bemerkt wurde, auf einem dreifüssigen Stativ (siehe Fig. 7), steckt auf die Spindel P des Kästchens B (siehe Fig. 9) die Rolle des 18 m langen lichtempfindlichen Films- oder Celluloidbandes auf, richtet das Objectiv O gegen die aufzunehmende Scenerie, schliesst die Öffnung E durch ein zugehöriges Thürchen, öffnet das Objectiv, dreht im entsprechend geeigneten Momente mit der Kurbel M derart, dass man pro Secunde etwa zwei Umdrehungen ausführt, tun damit die Activirung der Aufnahme in 900 Photogrammen pro Minute zu bewerkstelligen. Das exponirt gewesene Filmsband hat sich auf der Spindel T im Kasten A aufgewickelt und wird dann in der Dunkelkammer wie eine gewöhnliche photographische Aufnahme entwickelt, fixirt, verstärkt etc.
Soll der Apparat zur Herstellung der Positiv-Photogramme in Verwendung kommen, so wird in dem Kästchen B des Apparates auf die obere Metallspindel P die Rolle eines 18 m langen lichtempfindlichen Celluloidstreifens aufgesteckt, auf der darunter liegenden Spindel Q dagegen, welche in der Figur 9 punktirt dargestellt ist, das Band mit den Negativ-Photogrammen. Während der Abwicklungsbewegung und beim Passiren vor dem Objective O ist das Negativband innig im Contacte mit dem lichtempfindlichen Celluloidbande für die Positivbilder und es geht die Copirarbeit vor sich. Im weiteren Verlaufe des Abwärtsgehens beider Streifen trennen sich dann beide, der Positivstreifen mit den Copirungen rollt sich auf der Spindel T im Dunkelraume des Kastens A auf, der Negativbildstreifen dagegen bewegt sich durch einen Schlitz im Boden des Kastens bei H aus demselben heraus und wird zusammengerollt und in einer Blechbüchse dann verwahrt.
Zum Gebrauch des Apparates behufs Projection der bewegten Scenerie auf einen transparenten feinen Stoffschirm, welcher Schirm etwa 5 m weit vom Apparate entfernt sein soll, dient zur Activirung der Projection Molteni's elektrische Bogenlichtlampe. Fig. 8 versinnlicht beiläufig die Zusammenstellung und bedeutet L, L die elektrische Lampe, A, A den Kinématographen und S den Schirm für die Bilddarstellung. Das Locale, in welchem die Darstellung der Bilder stattfindet, muss selbstverständlich dunkel gehalten sein.
Diese Darstellungen "lebender Photographien" sind nicht nur des Vergnügens wegen zu Schaustellungen von Interesse, sondern hauptsächlich zum Studium der Bewegungsmechanik im Allgemeinen geeignet. Wird mit der Kurbel M der Apparat während der Darstellung des Bildes mehr oder weniger langsam oder schnell gedreht, so werden auch die Bewegungs-Erscheinungen in der Projection nach Wunsch langsamer oder schneller, sie können so langsam zur Darstellung gelangen, dass man das geringfügigste Detail der Bewegung ersehen kann. Wird aber bei der Kurbeldrehung die der belebten Scenerie entsprechende Geschwindigkeit in Anwendung gebracht, so haben wir die naturgetreue Wiedergabe der bewegten Scene, das heisst im wahren Sinne des Wortes "eine lebende Photographie" vor uns.
Um den verehrten Anwesenden nur beiläufig eine Idee davon zu geben, was die Demonstration des Apparates Ihnen vorführen wird, so will ich, nachdem ich das Programm des Herrn Dupont für den 12. Mai nicht kenne, jene Bilder skizziren, welche gelegentlich meines Vortrages über diesen Gegenstand am 27. März d. J. im Niederösterreichischen Gewerbe-Verein vorgeführt wurden und welche ungetheilten und enthusiastischen Beifall fanden.
Erstes Bild. Ein geschlossenes Fabriksthor erscheint auf dem weissen Schirme des dunkel gemachten Vortragssaales. Mit einem Male springen die Thorflügel der Fabrik auf, hunderte von Arbeitern und Arbeiterinnen strömen plötzlich aus dem Thoreingang heraus, Bicyclisten fahren aus dem Hofe, einer ist nicht rasch genug im Aufsteigen und führt dann das Rad weiter. Zum Schluss kommt aus dem Fond des Hofes ein Wagen mit Schimmeln bespannt heraus, direct auf die Zuschauer zu, biegt aber um die Ecke und verschwindet.
Zweites Bild. Frühstücksscene der Familie Lumière im Garten. Madame Lumière schenkt sich Kaffee in die Tasse ein, Papa Lumière füttert sein Söhnchen mit Mehlkoch; dabei sieht man im Hintergrunde das Laubwerk der Gesträuche sich im Winde bewegen, welche Luftbewegung auch an dem Spitzenkragen des Baby sichtbar ist. Dieses Bild präsentirt sich reizend.
Drittes Bild. Ein auf einem Platze in Lyon anfahrender Scheerenschleifer fasst Posto und beginnt seine Schleifarbeit. Publikum zieht vorüber, im Hintergrunde verkehrt die Tramway. In der Nähe der Schleifbank steht der Ziehhund des Schleifapparates, welcher das sich drehende Rad der Schleifbank anbellt; man sieht dabei sehr deutlich des Hundes Brustkorb arbeiten und ihn dabei mit der Ruthe wedeln.
Viertes Bild. Der Faschingszug zu Nizza mit seinen charakteristischen Gruppen voll Leben und Reiz.
Fünftes Bild. Die "verpatzte" Kartenpartie. An einem Tische im Garten drei Spieler, wo der linke davon Herr Lumière selbst ist. Das Spiel wird immer lebhafter. Lumière zündet sich eine Cigarre an, deren Qualm recht deutlich im Bilde ersichtlich ist. Der Spieler in der Mitte der Partie empfängt von einem herbeigeeilten Kellner einen Krug Bier und schänkt es in drei auf einer Tasse bereit gehaltene Gläser ein, bei welcher Gelegenheit die Schaumbildung und das Aufbrausen des Bieres recht deutlich zu sehen ist. Mittlerweile sind die drei Spieler durch das "Patzen" des einen in recht lebhafte Aufregung zum Wortwechsel gekommen, welcher sich schliesslich durch ein "Prosit" mit dem erfrischend wirkenden Biere in Wohlgefallen auflöst.
Sechstes Bild. Am Meeresstrand; weissperlende Wellen eilen an das flache Ufer heran, zerfliessen an demselben so täuschend, dass man thatsächlich Wasser zu sehen vermeint. Von einem Sprungbrett stürzen sich die Badenden in die Fluthen, welche hoch emporzischen und die Badenden dann, vom Wellenschläge getrieben und vom Wellenübersturze überfluthet, gegen das Ufer mitschwemmen. Eine der schönsten Scenerien.
Siebentes Bild. Eine Eisenbahnstation; aus der Ferne sieht man winzig klein die Locomotive eines Eilzuges heranbrausen, sie wird immer grösser und grösser, der Schlott qualmt, es fehlt nur, dass man noch pusten und das Rädergepolter hörte. Endlich ist der Zug da, die Locomotive riesengross, es scheint, als wollte sie in die Zuschauer hineinfahren. Da auf einmal verschwindet sie am linken Bildrande des hellerleuchteten Schirmes, die Waggons sind sichtbar, der Zug hält an; die Conducteure steigen ab, aus dem Perron tritt das Publikum zum Einsteigen. Ein lichtgekleideter Herr sieht suchend umher und läuft endlich fort, das natürlichste Durcheinander bei den Waggons, wie es in Wahrheit auf einem Bahnhof beim [Einsteigen] Ein- und Aussteigen vor sich geht.
Achtes Bild. Der Umsturz einer Mauer. Im Garten des Herrn Lumière wird unter seiner Aufsicht eine baufällige Mauer demolirt. Zwei Arbeiter hauen die Mauer zunächst mit der Krampe unten an, dann wird von rückwärts eine Wagenwinde gegen dieselbe angelegt, in Action gesetzt und die Mauer fängt bald an sich zu neigen und stürzt endlich ein, ungeheuere, das ganze Bild verdeckende Staubmassen aufwirbelnd. Bald legt sich die Staubwolke, die drei Personen kommen wieder zum Vorschein und nun wird der Mauerblock erst weiter behufs Zertheilung mit der Krampe bearbeitet.
Neuntes Bild. Ein Dampfer mit Passagieren landet. Die Passagiere betreten die Ausbarkirungsbrücke, darunter sind viele Amateure mit dem Kodak in der Hand oder unter dem Arm zu bemerken; der letzte der Passagiere mit solchem Apparat in der Hand grüsst direct in den Zuschauerraum, natürlich zur grössten Heiterkeit des Publikums.
Der Effect dieser Bilder war, wie schon bemerkt, ein verblüffender. Ich danke noch den verehrten Anwesenden bestens für die Aufmerksamkeit, welche sie trotz so vorgerückter Stunde meinen Ausführungen entgegenbrachten, schliesse hiemit meinen Vortrag und lade sie noch zur Besichtigung der ausgestellten Objecte in farbiger Reproduction, welche in den Ateliers der k. k. Hof- und Staatsdruckerei hergestellt wurden, höflichst ein.
Fig. 7. Der Kinématograph als Aufnahms-Apparat und zum Copiren.
Fig. 8. Der Kinématograph zur Projection.
Fig. 9. Inneres des Apparates, von der Seite und von vorne geöffnet.
Fig. 10. Obere Ansicht des Querschnittes.
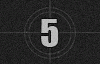
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.