Full Document
Der Tag, 1913, 25. 5.(I) + 1.6.(II) + 8.6.(III)
[Der Tag 1913, 25.5.(I) + 1.6.(II) + 8.6.(III) Brunner, Karl: ...]
Der Tag 1913, 25.5.(I) + 1.6.(II) + 8.6.(III)
Brunner, Karl: Kinostudien im Ausland
Nachdruck: HOWA'015
I
Lange schon sucht der menschliche Geist, nach einer für alle Völker leicht verständlichen Weltsprache. Im Kinematograph, obschon er wortlos ist, scheint sie gefunden zu sein. und niemand braucht sie erst zu erlernen. Der kinematograph, das Cinema, der Bio umspannt den Erdball und redet gleich vernehmlich zu allen Nationen. In welchem Land man auch reisen mag, überall trifft man auf seine Spuren, die sich dem Fremden bei seinem Eintritt in eine Stadt geradezu aufdrängen; und dieselben Schlager, die in Berlin den Kinematographen beherrschen, sind mir begegnet auf weithin leuchtenden Plakaten in Prag, in Wien, an der Adria, in Mailand, in Lyon, in Genf, Bern und Zürich.
Der Kinematograph stellt ohne Zweifel ein Kulturproblem im Leben der Völker dar; es gewährt einen eigenartigen Reiz, diesem Problem nachzugeben, und es im Hinblick auf die eigenartigen Verhältnisse der einzelnen Nationen zu studieren.
Ich habe einen kurzen Urlaub dazu benutzt, um einige benachbarte Länder zu besuchen und dabei dem Kino meine besondere Beachtung zu widmen. Es galt dabei, in vieler Beziehung Entsagung zu üben und an gar manchem, das unentlich wertvoller und dankbarer gewesen wäre als der Besuch von täglich fünf bis sechs Kinos, resigniert vorbeizugehen.
Auf was alles musste ich verzichten - um von Prag und Wien zu schweigen - als ich auf dem geweihten Boden der Kunst in Italien wandelte! Nie empfand ich dies mehr als in Venedig, wo einem die Zeugen einer einzigartigen [Kulturentwicklung] Kultur- und Kunstentwicklung von Jahrhunderten auf Schritt und Tritt entgegentreten und selbst der einfache Volksgesang, der am Abend aus lampion-geschmückter Gondel über die Lagunen klingt, echte Kunst bedeutet gegenüber den Talmi des Kinematographen, der sich abseits von den Kunststätten meist in obskuren Räumen eingenistet hat.
Dass der Kinematograph in künstlerischer Beziehung keinen Fortschritt bedeutet, ist mir in Italien angesichts der Fülle echter Kunstdokumente, die dort das ganze Volkstum in Vergangenheit und Gegenwart aufweist, unwiderleglich klar geworden. Darum ist es aber keineswegs ausgeschlossen, dass der Kinematograph im Leben der Völker eine kulturfördernde Rolle von grosser Bedeutung - über das blosse Unterhaltungsbedürfnis hinaus - spielen kann. Bei dem Einfluss den die neue Erfindung in kurzer Zeit allenthalben gewonnen hat, ist diese Wirkung unausbleiblich, vorausgesetzt, dass es auch bei anderen Völkern möglich ist, wie dies bei uns in Deutschland - allerdings im Kampf gegen die Kinos allmählich zu gelingen scheint, die schädlichen Auswüchse erfolgreich zurückzudrängen.
Hinsichtlich des äusseren Betriebes steht es in den von mir besuchten Ländern, soweit die eigentlichen Volkskinos in Betracht kommen, besser als bei uns, namentlich als hier in Berlin mit der ungesunden Überfülle von Kinotheatern, die in gleichem Zahlenverhältnis keine andere Stadt Europas aufzuweisen hat. In dieser Beziehung ist es allerdings dringend zu wünschen, dass durch die Einführung des Konzessionszwanges mit den heilsamen Begleiterscheinungen gründlich Wandel geschaffen wird. Die Qualität der Darbietungen freilich wird bei uns durch die sorgfältig gehandhabte Präventivzensur der Behörde erheblich verbessert gegenüber dem, was man vielfach im Ausland zu sehen bekommt. Seltsamerweise sind wir, abgesehen von der Zensur, in Deutschland gerade hinsichtlich der behördlichen Einwirkung auf das Kinowesen hinter anderen Völkern zurückgeblieben und leiden infolgedessen noch unter Kinderkrankheiten des Kinematographenbetriebs, die in manchen anderen Ländern nicht zu finden sind.
Trotz aller Klagen unserer Kinointeressenten über besondere Belästigung durch behördliche Massnahmen in Deutschland muss gesagt werden, dass in anderen Ländern vielfach ein bedeutend weitergehender, dort aber als selbstverständlich empfundener Zwang besteht, demgegenüber bei uns eine Freiheit herrscht, die namentlich in kleineren Kinotheatern zu einer gewissen Verwilderung geführt hat und die erst jetzt -- zweifellos sehr verspätet -- durch gesetzliche Massnahmen in die notwendigen Schranken verwiesen werden soll. Ich erinnere nur an die Konzessionspflicht, die in Österreich, Italien, zum Teil auch in Frankreich und der Schweiz besteht: auf die Überwachung der Reklame, die Vorschriften von Zwischenpausen und regelmässiger Lüftung die Anlage von Warteräumen usw.
Meine Reise führte mich zunächst nach Prag, der prächtigen Hauptstadt Böhmens. Bald nach Verlassen des Bahnhofs stösst man hier in den belebten grossstädtischen Strassen auf riesige Reklamewände, wo neben anderen Ankündigungen die Plakate von nicht weniger als elf grossen Kinotheatern oder "Bio", wie der Tscheche sagt, einen auffallend grossen Raum einnehmen. Doch sind die Ankündigungen mehr nach Art der Bühnentheater gehalten. nicht schreiend, ohne Bilder. In den Tageszeitungen, sowohl im redaktionellen wie im Anzeigenteil, sind die Bios gleichfalls stark vertreten, und zwar in tschechischen wie in deutschen Blättern ohne Unterschied. Hier schweigt der nationale Gegensatz, der auf anderen Gebieten so scharf hervortritt. Im Kino ist ein neutraler Boden geschaffen, auf dem Deutsche und Tschechen sich friedlich zusammenfinden. Das tritt auch in den Titeln der Films hervor, die meist zunächst in deutscher Sprache erscheinen und dann erst in tschechischer Übersetzung. Der Absatz des Filmmarktes ist im tschechischen Sprachgebiet so gering, dass die Filmfabriken besondere tschechische Ausgaben ihrer Erzeugnisse gar nicht herstellen, sondern sie mit deutschen Titeln liefern. So muss sich der Kinobesitzer selbst helfen. Er stellt auf weissem Papier eine handschriftliche Übersetzung her, macht ein Diapositiv daraus und zeigt dieses, nachdem er den deutschen Titel im Film vorgeführt und die laufende Filmrolle beiseite geschoben hat, einige Sekunden lang seinem Publikum.
Es gibt in Gross-Prag, das unter Einrechnung der ansehnlichen Vororte Zizkow, Smichow, Königliche Weinberge usw. über 500000 Einwohner zählt, zurzeit etwa dreissig Bios. Bezeichnenderweise erhielt ich auf Nachfrage bei einfachen Leuten aus dem Volke, Kutschern, Hotelportiers u. a., nach der Zahl der Kinotheater in allen Städten, die ich besuchte, übertriebene Zahlenangaben, die sich oft aufs [Dreifache] Drei- bis Vierfache der tatsächlichen Ziffern erstreckten, ein Beweis, welch tiefen Eindruck das Überhandnehmen der Kinematographen im Bewusstsein des Volkes hervorruft. Auch der mir in freundlicher Weise von der "Deutschen Auskunftsstelle" vermittelte Führer, der mich auf meinen Gängen in die verschiedenen Bios begleitete, gab die Zahl auf das Doppelte an.
In der inneren Stadt sind die grossen Kinotheater verhältnismässig nahe beisammen, in den vorwiegend von Arbeitern bewohnten äusseren Bezirken dagegen sind sie auffallend dünn gesät. Im allgemeinen zeigen die Tschechen noch keine sehr grosse Begeisterung für das Kino. Das Gros der Besucher setzt sich anscheinend mehr aus dem deutschen Mittelstand als aus den tschechischen Massen zusammen. So kommen die besseren Bios, die eben um ein sehr vornehmes in der Passage am Wenzelplatz vermehrt werden, eher auf ihre Rechnung als die Volkskinos, von denen ich eines in dem grossen Vorort Zizkow am späten Sonnabend-Nachmittag fast nur von Kindern besucht fand, ein Theater übrigens, das trotz der niedrigen Preise (20 Heller, für Kinder die Hälfte) in seiner Reklame, in seinen Räumlichkeiten und in seinem Programm sehr vorteilhaft von gar vielen unserer Berliner "volkstümlichen" abstach. Sonst bewegen sich die Eintrittspreise meist zwischen 30 Heller und 1.50 Krone. Die Frontreklame in den Kinotheatern ist gerade in Prag auffallend dezent gehalten, das schreiende, durch hässliche, farbige Riesenbilder abstossenden Plakat fehlt hier ganz. Die Ankündigungen sind meist zweisprachig und verleugnen in ihrer Ausstattung keineswegs das Bestreben, mit den geschäftlichen Zwecken eine gewisse ästhetische Volkskultur zu verbinden.
Die erwähnte Zurückhaltung der Massen gegenüber dem Kinematographen sucht man -- das ist wenigstens mein Eindruck -- unter verständiger Leitung kulturell gerichteter Interessentenkreise nicht durch aufregende Sensatiansmache, sondern durch Betonung des Bildungswertes des Kinematographen zu überwinden. Unter diesem Gesichtspunkte betreibt die sozialdemokratische Partei schon seit etwa drei Jahren in ihrem an der verkehrsreichen Hybernergasse gelegenen grossen Volkshaus ein Lidovy-Bio (Volkskino), das zu den besten der Stadt zählt. In eigener Druckerei werden die Plakate hergestellt, die ebenso anständig wie wirkungsvoll erscheinen. Bezeichnend ist es, dass gerade hier die besten Filmdarstellungen geboten werden, die bei uns meist auf die ganz vornehmen und teuren Kinotheater beschränkt sind. So wurde bereits in der vierten Woche der Film "Quo vadis?" unter gewaltigem Andrang gespielt. Karten waren nur im Vorverkauf zu erlangen, obschon der niederste 60 Heller betrug. Auch in den übrigen Bios, die ja in Österreich bekanntlich alle der Zensur unterstellt sind -- in Böhmen wird diese von der Statthalterei unter Zuziehung pädagogischer Beiräte ausgeübt -- fand ich manche wertvolle Darbietungen und selbst bei den Dramen sozusagen die bessere Qualität vorherrschend. In der Vorortgemeinde Weinberge wird im Herbst dieses Jahres im Gemeindehaus ein kommunales Kinotheater eröffnet werden.
Der Gesamteindruck, den ich vom Kinowesen der böhmischen Hauptstadt gewonnen habe, war kein ungünstiger. Einerseits die verständigen Massnahmen einer mit weitgehender Vollmacht ausgestatteten Regierung, andererseits weitreichende Einflüsse, die ausserhalb der geschäftlichen Interessen liegen, haben die Entwicklung hier in erfreuliche Bahnen gelenkt.
II
In Wien, wohin mich der Weg zunächst führte, tritt das Kinematographentheater auf den ersten Blick nicht auffallend in die Erscheinung. Man entdeckt an den Anschlagsäulen und Reklamewänden mitten unter dem [Konzertplakaten] Konzert- und Bühnentheaterplakaten auch einige kinematographische Ankündigungen, die sich jedoch nicht besonders hervorheben, vielmehr unter die übrigen Veranstaltungen einreihen. Man merkt es an der ganzen Reklame, dass die Zeusur auch über die Plakate wacht.
Auch im Strassenbild wirken die Kinos keineswegs aufdringlich. Man muss in manchen belebten Stadtgegenden erst nach ihnen suchen. Ganz Wien hat zurzeit 117 Kinotheater. Die Konzessionspflicht, hier "Lizenz" genannt, übt zweifellos eine gute Wirkung aus und bewahrt vor einem Übermass, das sich bei uns nach verschiedenen Richtungen in ungünstiger Weise geltend macht.
Die Verordnung des Ministeriums des Innern vom 18. September 1912, in Kraft getreten seit 1. Januar 1913 bestimmt folgendes: "Die Veranstaltung öffentlicher Schaustellungen mittels eines Kinematographen ist nach den bestehenden Vorschriften nur auf Grund einer behördlichen Lizenz zulässig. Die Lizenz wird für einen Zeitraum von einem bis zu drei Jahren erteilt. Die bekannte Novelle zur Gewerbeordnung, betr. Unterstellung der Kinotheater im Deutschen Reiche unter die Konzessionspflicht nach §§ 33 a, die bereits dem Bundesrat vorliegt und demnächst an den Reichstag gelangen wird, kann nicht besser unterstützt werden als durch den Hinweis auf die Erfahrungen, die man in Österreich mit der "Lizenz" gegenüber den Kinos gemacht hat. Es wäre nur zu wünschen, dass der eine oder der andere Fehler, der im österreichischen System liegt, bei uns vermieden werde. Ich denke dabei besonders an die Frage der Stellvertretung für den Inhaber der Konzession, die in Österreich zu mancherlei Missständen führt. So drängen sich unter der Flagge gemeinnütziger Bestrebungen mitunter unliebsame Persönlichkeiten an die leitende Stelle von Unternehmungen, die ihnen selbst nicht konzessioniert worden wären. Erfreulich hingegen ist die praktische Mitarbeit an der Kinoreform seitens der Volks- und Arbeiterbildungsvereine. Die Wiener Urania z. B. bietet "Kinematogramme" mit belehrendem Vortrag" (Eintritt 0.30 -- 1.29 Kr.), einige Arbeiterheime sowie eine Volkslesehalle veranstalten regelmässige Kinovorstellungen. Am Sonntag freilich, als ich das stattliche Arbeiterhaus in Ottakring aufsuchte, erfuhr ich, dass an [Sonntagen] Sonn- und Festtagen statt des Kinos das Sprechtheater in diesen schönen Räumen herrscht -- zweifellos ein gesunder Grundsatz, der vor Einseitigkeit und Geschmacksverbildung bewahrt. Der Andrang war sehr stark. Man sieht, bei richtiger Leitung können wohl beide Arten von Verstaltungen nebeneinander bestehen, ja, einander unterstützen. Freilich wird sich eine solche Kompensation nur im Rahmen von Vereinsveranstaltungen ermöglichen lassen.
Den österreichischen, speziell den Wiener Kinotheatern, auch solchen niederen Ranges, muss man die Anerkennung zollen, dass ihr Betrieb ein sehr geordneter, übersichtlicher ist: Der Spielplan mit genauer Angabe der Spielzeit und -dauer [Spieldauer] ist in anständiger Form -- Worten wie "Schlager", "Sensation" u. a. begegnet man äusserst selten -- am Eingang angebracht. Während der Vorstellung des Programms findet im allgemeinen kein Zutritt statt. Die neuankommenden Besucher sammeln sich in einem besonderen Warteraum, bis die Vorführung beendet, das Theater geleert und einige Minuten lang gelüftet ist. Zugang und Abgang erfolgen durch verschiedene Türen. Das beruht alles auf sehr zweckmässigen Verordnungen der Behörde. Wie viele Missstände, über die wir hierzulande zu klagen haben, sind dadurch unmöglich gemacht! Das Rauchen ist wie bei uns selbstverständlich untersagt, auch fand ich nirgends einen Wirtschaftsbetrieb im Zuschauerraum. Manche Kinos, selbst sehr einfache, sind mit gedämpftem Licht während der Vorführung erhellt. Von zahlreichem Aufsichtspersonal wird alles gut vorbereitet und in Ordnung gehalten; der eine oder der andere aus dem Publikum wird gefragt, ob er gut sehen könne. Darauf meinte ein Herr in meiner Nähe: "I bitt schön, Herr Direktor, der Damenhut geniert mich!" "Der kommt herunter!" war die prompte Antwort, der alsbald die Tat folgte.
Das Spiel beginnt in den vornehmen Kinos meist schon um 4 oder 5 Uhr nachmittags, in den volkstümlichen etwa um 7 Uhr, Sonntags erheblich früher, vielfach schon vormittags 1/2 11 Uhr mit einer [zweistündigen] zwei- bis dreistündigen Mittagspause. Um 10 Uhr abends tritt nach guter alter Wiener Sitte Ruhe ein. Die Spieldauer beträgt meist eine knappe Stunde. Das Drama herrscht unbedingt vor, im Volkskino bildet es neben einer kurzen Naturszene und einem humoristischen Film den einzigen Inhalt, Wochenschau u. a. kennt man nur in besseren Theatern. Jugendliche bis zu 16 Jahren haben ungehindert Zutritt bis zu 8 Uhr abends, sofern nicht gewisse Bilder von der Zensur für sie verboten sind -- Einschränkungen, die nicht streng genug gehandhabt werden und in der Praxis fast keine Bedeutung haben. Der mangelhafte Jugendschutz wird in weiten Kreisen Österreichs beklagt. Man begegnet Kindern allenthalben im Kino, mitunter glaubt man sich in eine Kinderstube versetzt.
Die Präventivzensur, die in Wien die k. k. Polizeidirektion ausübt, hat auf Grund einer Vereinbarung mit dem Statthalter ihre Geltung für ganz Niederösterreich und kommt auch für andere Kronländer -- ähnlich wie dies in Berlin für ganz Preussen der Fall ist -- durch Anerkennung der Wiener Zensurkarte teilweise einer Reichszensur gleich.
Als Kuriosum sei noch erwähnt, dass in dem bekannten Varieté von Ronacher eine besondere Kino-Attraktion zu sehen war: "Fritzchen, der weltberühmte kleine Kinoschauspieler aus Paris, persönlich im Ballon, im Film und auf der Bühne." Der etwa achtjährige Junge spielte mit seinem wenig jüngeren Schwersterchen einen Sketch recht amüsant, aber ganz unkindlich. Bei uns in Deutschland wäre im Hinblick auf das Kinderschutzgesetz ein solches Auftreten von Kindern unmöglich.
Von Wien brachte mich der Nachtzug nach Fiume, der kgl. ungarischen Freistadt. In den Küstenländern verrät schon die Art der Ankündigung der Kinematographen [in HOWA: Kinomatographen] das lebhafte südländische Temperament. Hier ist viel und auffallend die Rede von "Sensation", "grandiosem Erfolg" und besonders von Liebesabenteuern (Dramma sensazionale, pieno d' avventure amorose). In Fiume mit über 40000 Einwohnern, die sich aus Italienern, Kroaten, Madjaren, und Deutschen zusammensetzen, sind sieben Kinos, im benachbarten Bad Abbazia zwei bis drei. Auf den Plakaten herrscht die italienische Sprache vor, daneben findet sich auch die ungarische und die kroatische. In Ungarn besteht keine Vorzensur. Nach der Mitteilung eines Polizeibeamten findet nur eine allgemeine Überwachung der Kinotheater unter Beobachtung ordnungspolizeilicher Gesichtspunkte statt. Besondere Bestimmungen bestehen, abgesehen von den notwendigen Sicherheitsvorschriften, nicht. Weder die Zeit der Vorführung noch die Zulassung von Kindern unterliegt behördlicher Einschränkung. Eine auffallende Reklame beherrscht die Plakatsäulen. Auf den Strassen und in den Restaurants fliegen einem die Theaterzettel der Kinematographen zu. Diese enthalten meist sehr ausführliche Inhaltsangaben der Dramen, die nahezu den einzigen Gegenstand der Schaustellung bilden.
In Triest, das ja bekanntlich ein starkes italienisches Gepräge aufweist, tritt die Reklame ganz der augenfälligen Manier der farbenfreudigen Italiener zutage; wenn auch die hier in den österreichischen Ländern geltende Zensur manche Einschränkung auferlegt, so trägt sie doch begreiflicherweise dem Volkscharakter Rechnung. Die Stadt mit ihren mehr als 200,000 Einwohnern hat achtzehn Kinematographen, von denen sich drei in einer Hand befinden. Unter den Besuchern ist das Militär stark vertreten, das selbstverständlich bedeutende Ermässigung geniesst. Auffallend viele kleine Kinder sah ich auf dem Schoss der Mütter. Ihre lauten Stimmchen mischten sich in die lebhaften Gefühlsäusserungen des empfänglichen Publikums. Die Eintrittspreise betragen durchschnittlich 30 bis 80 Centesimi. Hier herrscht fast nur das Drama, das ab und zu mit humoristischen Bildern wechselt. Naturszenen sind, wie mir versichert wurde, gar nicht beliebt, aktuelle Bilder, Wochenschau u. a., werden nur selten begehrt. Bilder vom nahen Kriegsschauplatz machen eine Ausnahme. Besonderem Interesse begegnen die Films der "Nordischen" mit ihren stark dramatischen Effekten. Bei der Vorliebe des Italieners für die Schauspielkunst ist die lebhafte persönliche Anteilnahme des Publikums gegenüber den Hauptdarstellern der Kinodramen begreiflich. Die zur Verteilung gelangenden Theaterzettel nehmen besondere Rücksicht darauf. Sie enthalten nicht nur die Namen der wichtigsten Schauspieler, sondern bringen meist auch ihre Bildnisse, die mitunter in Form von Postkarten an die Besucher der Kinotheater kostenlos abgegeben werden. So tritt das Volk in gewisse nähere Beziehung zu den Künstlern, es kommt für die Beschauer mehr die schauspielerische Leistung als suggestive Wirkung des Dramas in Betracht.
Darin mag vielleicht bis zu einem gewissen Grad ein ausgleichendes Moment gegenüber den ästhetischen und ethischen Nachteilen liegen, die unter anderen Verhältnissen das Kinodrama mit sich bringt, und zugleich auch ein [in HOWA: nie] Milderungsgrund in der Beurteilung des Kinowesens in Italien, das hinsichtlich der Darbietungen nahezu keinerlei Beschränkung unterworfen ist.
III
Venedig, dem ich mich von Triest aus zuwandte, besitzt etwa zehn Cine-Teatri, die aber, an denen anderer Grossstädte gemessen, durchweg nur einen bescheidenen Charakter tragen, da sie begreiflicherweise vom Fremdenverkehr fast unberührt bleiben und wohl nur auf die unteren und einige mittlere Kreise der einheimischen Bevölkerung berechnet sind. Etwas anderes als Dramen kennt man hier überhaupt nicht, als Zugabe hie und da eine komische Szene. Das Publikum spielt hier gewissermassen mit und bekundet namentlich bei den Humoresken laut seine Teilnahme an den Vorgängen auf der weissen Wand. Das gilt besonders von den zahlreich anwesenden Kindern; in einem Kino hatte ein dreijähriger Junge zum Gaudium der übrigen Besucher das grosse Wort. Die Lebhaftigkeit des Italieners bringt mitunter den Leiter des Unternehmens in Verlegenheit. Tritt eine grössere Pause ein, so äussert das Publikum sein Missfallen durch Zuruf und Stampfen in unverholener Weise, dasselbe geschieht, wenn irgendeine Vorführung den Beschauern nicht behagt, namentlich, wenn sie nicht genug "dramatisch bewegt" ist. Die Pausen im Theater wie die Zeit in den Warteräumen, die, wie in Österreich, auch in Italien allgemein vorhanden sind, wird mit Musik (Grammophon u. a.) ausgefüllt.
Ich habe unter der Führung des neunjährigen Sohnes meines Hotelwirtes, eines aufgeweckten Jungen mit dem klassischen Vornamen Plinio, fast alle Kinos der Lagunenstadt besucht, die man ohne ortskundige Anleitung in den versteckten Winkeln und Gassen kaum finden könnte. Mein junger Begleiter wusste trefflich Beischeid in allem.
Bei den eigentümlichen Lokalverhältnissen Venedigs ergeben sich mitunter seltsame Zustände. Das eine Kino ist in einem kirchenähnlichen Raum untergebracht, der wohl einst bessere Tage gesehen, ein anderes in einer luftig gebauten Halle, an deren Decke die Vögel nisten und mit Zwitschern die monotone Klavierbegleitung übertönen.
In Italien bestehen gewisse ortspolizeiliche Bestimmungen für die Kinos. Die vorzuführenden Films bedürfen der Genehmigung "zum Anschlag und zur Vorführung", aber im allgemeinen werden nur die Titel, nicht die Bilder selbst, vorher geprüft, so dass eine eigentliche Zensur nicht besteht. Das Rauchen und das Stehen auf den Gängen ist streng verboten. Vorgeschrieben ist die feuersichere Ausstellung des Apparats, ein Warteraum und ein doppelter Ausgang. Die Konzession wird nach der Bedürfnisfrage geregelt. Eine besondere Steuer, die durchschnittlich für ["für" fehlt in HOWA] 100 Plätze auf 5 Lire berechnet ist, wird erhoben. Am späten Abend erlebte ich noch eine angenehme Überraschung in einem Kaffeerestaurant an der Riva degli Schiavoni, wo in dem einen Raum ein Konzert, in dem anderen eine kinematographische Vorführung bis gegen Mitternacht stattfand. Es wurde bei Beleuchtung gespielt, ohne dass die Darstellung darunter litt. Zum erstenmal seit meiner Abwesenheit von Deutschland traf ich hier eine von guten, nichtdramatischen Bildern (schönen Naturszenen, aktuellen Films) und nur nebenbei eine dramatische Szene. Da ein Eintrittsgeld nicht erhoben wird, hat der Unternehmer auch keine Steuer zu bezahlen. Es findet nur ein geringer Aufschlag für die Speisen und Getränke statt.
Ein anderes Bild bietet die Stadt Mailand mit ihren zahlreichen, zum Teil sehr grossen und vornehmen Kinematographen, bei etwa 600,000 Einwohnern, gibt es hier etwa 30 Kinos, die namentlich am Abend das ohnehin sehr belebte Strassenbild stark beeinflussen. Im Corso Vittore Emanuele ist das Pflaster dicht besät mit Reklamezetteln der Kinotheater. Die nach der Strassenseite weithin offenen Warteräume sind dicht mit Menschen gefüllt, die bis ins Freie hinaus sich drängen und in lebhafter Bewegung des Eintritts harren; denn hier wird meist in abgeschlossenen Vorstellungen gespielt, während deren nur kurzen Dauer der Zutritt nicht gestattet ist. Der Sturm auf die Kasse ist so lebhaft, dass durch Plakate vor allzu grossem Andrang gewarnt werden muss. Weithin strahlt die gewaltige Lichtreklame von den Kinopalästen und lockt immer neue Massen an, die bis gegen Mitternacht Zutritt zu den Stätten ihrer Sehnsucht erhalten. Bei dem regen Nachtleben, das in Mailand herrscht, beginnen die Vorstellungen spät, meist gegen 8 Uhr und enden spät. Einzelne Theater allerdings spielen von 13 1/2 (Sonntag von 11 1/2) -- 24 Uhr; die Zulassung der Kinder auch am Abend ist unbeschränkt. Die bei Venedig erwähnten polizeilichen Bestimmungen und Steuervorschriften gelten auch für Mailand. Das Publikum rekrutiert sich hier auch aus besseren Kreisen. Die Kinotheater machen zum Teil einen eleganten Eindruck; manche fassen bis zu 1000 Zuschauern. Ein einziger Unternehmer besitzt nicht weniger als 12 Theater in der Stadt. Die Eintrittspreise sind ziemlich niedrig, meist 30 und 60 Cent, dazu kommt noch eine besondere Ermässigung durch die sog. Scontrini, d. h. Rabattscheine, die entweder beim Eintritt kostenlos mitgegeben werden, oder sonst gratis zu haben sind und eine Ermässigung von 50 Prozent auf den normalen Eintrittspreis erwirken. Es gibt selbst Konzertlokale bei deren Betreten solche Scondrini, für verschiedene Kinotheater gültig, verabreicht werden. Dass das Drama das Programm beherrscht, ist ja gewissermassen selbstverständlich. Die Vorliebe dafür ist so einseitig, dass in einem Kino, wo ausnahmsweise sehr hübsche Bilder aus Umbrien gezeigt wurden, die Zuschauer ihrer Missbilligung lauten Ausdruck verliehen und sich nicht eher beruhigten, als bis das ersehnte Drama an die Reihe kam, das auf das lebhafteste begrüsst wurde.
Wie Italien die Heimat der besten Filmschauspieler ist, so sind die Italiener auch das empfänglichste Publikum für ihre Darbietungen. Auffallen muss es, dass da nirgends ein Rezitator oder Erklärer auftritt. Ich bin überhaupt ausserhalb Deutschlands keinem solchen begegnet. Von Mailand reiste ich nach der Schweiz, wo ich in einigen Kantonen aufklärende Vorträge über die Kinofrage zu halten hatte, die zugleich zur Orientierung dienen sollten für gesetzgeberische Massnahmen. Man klagt ja in der Schweiz angesichts solcher Missstände, wie sie der Kinematograph mit sich bringt, mit Recht über die schweren Nachteile, die die Zersplitterung der Gesetzgebung und Verwaltung in den einzelnen Kantonen mit sich bringt. So sind denn die Verhältnisse in jeder Stadt verschieden; in der einen findet eine weitgehende Beschränkung statt, iu [in] der anderen herrscht fast völlige Freiheit. An manchen Orten sind Gesetzesreformen im Werk. Von der deutschen Schweiz verdient besonders Zürich Erwähnung. Dort hat die Regierung die grundsätzliche Trennung der Jugend von Erwachsenen im Kinotheater bestimmt. Diese Verfügung wurde seitens der Interessenten angefochten, die ihre Beschwerde bis vor das Bundesgericht in Lausanne brachten. Die oberste Schweizer gerichtliche Instanz hat aber im Sinne der Schweizer Regierung entschieden und ein Urteil von prinzipieller Bedeutung gefällt, das auch für uns in Deutschland nicht ohne Interesse ist. Es heisst da u. a.: "Dass die in den Kinotheatern gebotenen Schaustellungen häufig, wenn nicht meist, in irgendeiner Beziehung vom Standpunkt der Erziehung, öffentlichen Ordnung oder Sittlichkeit aus zu berechtigter Kritik Anlass geben, könne im Hinblick auf die gemachten Erfahrungen ernsthaft nicht mehr bezweifelt werden, so dass der Staat als Hüter der öffentlichen Ordnung mit vollem Recht zu polizeilichem Vorkehren legitimiert sei.
Ungünstiger liegen die Verhältnisse in der französischen Schweiz, wo in Genf, Lausanne und Neuchatel eine aufdringliche Reklame uneingeschränkt Sensationen aller Art -- darunter manche in Deutschland gänzlich verbotene Stücke -- ungehindert ankündigt. Die Zahl der Kinotheater ist in der Schweiz verhältnismässig gering.
Mein Weg führte mich weiter nach Frankreich, der eigentlichen Heimat des Kinematographen, dem Vaterland der Pathé und Gaumont. Ich hatte Lyon gewählt, vor allem deshalb, weil mir dort von befreundeter Seite eine sachkundige Führung in Aussicht stand. Die drittgrösste Stadt Frankreichs hat mehr als eine halbe Million Einwohner, dabei nur 17 Kinematographentheater. Die Firma Gaumont besitzt hier ein grosses [Verkaufsgeschäft] Verkaufs- und Verleihgeschäft, die " Compagnie Lyonnaise cinématographique ". Ich besuchte zunächst ein ganz volkstümliches Cinema in einem ärmeren Viertel. In einem früheren Zirkus untergebracht, erfreute es sich lebhaftester Frequenz seitens der Arbeiterbevölkerung, die regen Anteil an der Vorstellung nahm und verhältnismässig hohe Eintrittspreise bezahlte -- die meisten 80 Cent, ein kleiner Teil 50 und 30. Es war ein kalter Abend, der zweite Raum wurde durch Kohlenbecken erwärmt, deren glühender Inhalt seltsam durch das Dunkel der Halle leuchtete. In drei Abteilungen wurden verschiedene Dramen und Humoresken sowie ein Landschaftsbild vorgeführt. Dazu spielte ein Orchester seine Weisen. Das Gebotene war im ganzen einwandfrei. Beim Austritt bekamen wir Bons, die für weitere Besuche Vergünstigungen gewähren. Kaum hatten wir die Strasse betreten, so bettelten halbwüchsige Burschen um diese Karten, die wir ihnen auch überliessen. Hier in Lyon enthalten die Programme, ähnlich wie bei uns, meist eine kurze Titelangabe. Das Interesse am dramatischen Film, obwohl er fast den einzigen Inhalt der Vorstellung bildet, ist bei weitem nicht so gross wie in Italien. Die Strassenreklame ist zum Teil recht aufdringlich und unschön. Das bessere Publikum zeigt eine starke Zurückhaltung gegenüber dem Kinematographen, wie der vornehme Franzose überhaupt, ganz besonders aber in Lyon, sich sehr reserviert gegenüber allem Volkstümlichen verhält -- trotz des demokratischen Charakters der Republik eine ausgesprochene Exklusivität der bürgerlichen Aristokratie. Diese Kreise stehen dem Kinematographen noch völlig fern: sie kümmern sich auch nicht um die Schäden, die dem Volk, ganz besonders der Jugend, aus der Freiheit des Kinematographen erwachsen. Der Jugendschutz liegt hier sehr im argen. Mein Freund führte mich mit seinen Kindern, die er sonst nie ein Kino besuchen lässt, in eine gross angekündigte Kindervorstellung eines besseren Theaters, die von Jugendlichen stark besucht war. Aber wir waren entsetzt über das, was man Kindern hier zu bieten wagte, und trösteten uns nur mit dem Gedanken, dass unsere Kleinen das schlimmste nicht verstanden haben. Mein Freund aber ist für immer von seiner hoffnungsvollen Meinung über die Kinos bekehrt, die ich ihm beizubringen versucht habe. Wir Erwachsenen gingen im Anschluss daran noch in ein Kino des hochgelegenen Arbeiterviertels Croix-Rousse, wo an diesem Sonntagnachmittag die werktätige Bevölkerung Erholung von der Alltagsarbeit sucht. In einem hygienisch sehr bedenklichen Lokal, wo einzig und allein das Rauchverbot an das Vorhandensein der Behörden erinnert, sitzen dichtgedrängt Männer und Frauen, vor allem aber zahlreiche Kinder, lädt doch der Ausrufer am Eingang dazu ein, ein Kind umsonst mitzunehmen. Und was wurde gegeben? Drei Dramen, die sämtlich in Deutschland oder in Österreich unmöglich vorgeführt werden könnten, die jede Zensurbehörde einfach verboten hätte, darunter leider auch ein deutsches Fabrikat, das noch dazu technisch das schlechteste von den dreien war. So geniesst der französische Arbeiter mit seinen Kindern am Sonntagnachmittag seine Erholung
In einem anderen Kino konnte ich dagegen die erfreuliche Beobachtung machen, dass der gesunde Sinn des Franzosen die allzugrossen Albernheiten des Kinodramas energisch ablehnt und im Grunde genommen für sie höchstens ein spöttisches Lächeln hat.
So liegt auch hier ein Hemmnis, dass die Bäume des Kinodramas nicht in den Himmel wachsen. Jede Nation erwehrt sich auf ihre Art, der Gefahren, die ihren Besitzstand an idealen Gütern bedrohen. Aber mit der Selbsthilfe, die gegenüber den einmal aufgeregten Masseninstinkten nicht ausreicht, muss sich die staatliche Unterstützung durch eine zweckmässige Gesetzgebung glücklich vereinen.
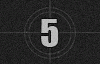
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.