Full Document
Schaubühne, 1911, Bd. VII.1, Nr.4, S.93-98
[Schaubühne 1911, Bd.VII.1, Nr.4, S.93-98 Paul, ...]
Schaubühne 1911, Bd.VII.1, Nr.4, S.93-98
Paul, Stefan
Kinematographie der wiener Oper
Hofoper: Beginn der Saison. Im Hause nichts. In den Zeitungen das 'Aktionsprogramm'. Enthält die meist schon bekannten Versprechungen. Aber dann kommt 'Zar und Zimmermann', neu einstudiert, von Walter dirigiert, eine höchst vortreffliche Aufführung. Man wird ganz biedermeierisch rührselig und sentimental und hat eine grosse Freude über das Tüchtige, Deutsche und bei aller scheinbaren Spiesserei Antiphiliströse dieser Oper. Man möchte sich die Haare raufen, dass keiner den Weg weiter gegangen ist. Sie spielten mit Szepter, mit Krone und Speer - jetzt spielen sie selbst mit dem Spiel nicht mehr.
Es folgt: 'Der Schneemann', die Pantomime des Elfjährigen, von der ich hier im Frühjahr gesprochen habe. Sie ist bald nach meinem Bericht in einer Wohltätigkeitsvorstellung aufführt, danach von der Universaledition verlegt und schliesslich, von Alexander von Zemlinsky instrumentiert, an der Hofoper gegeben worden. Ob dem Werk, dem genialen Spiel einer kindlichen Phantasie, das grosse Haus nicht seine eigentliche Wirkung genommen hat? Wenn es noch ein Reinhardt inszeniert hätte! In Wien war es ein Ballett in einer Kinderbuchszenerie. Selbst die Instrumentierung näherte sich dem kaiserlich königlichen Hofballettcharakter. Sehr schade. An einer kleinern Bühne mit intimern Wirkungen wäre Besseres daraus geworden als ein Zugstück, und der heute dreizehnjährige Komponist hätte mehr Freude und Nutzen davon haben können.
Volksoper: Hitzige Reden und Widerreden in den Zeitungen. Wird er oder wird er nicht? Der Direktor Simons nämlich. Er droht sehr ernsthaft, der Volksoper den Garaus zu machen, und der Theaterverein und die himmlisch ahnungslose Gemeinde Wien, die dahintersteht, prozessiert dieserhalb mit heiligem Ernst durch alle Instanzen. Getrost: er wird die Subvention bekommen. Denn das ist dieses klügsten Direktors letztes Ziel, und mit Recht. Die Stadt Wien, die zur Repräsentation und für eigene Unternehmungen Geld genug ausgibt, hat die Pflicht, das einzige wiener Privattheater zu unterstützen, das erschwingliche Opernvorstellungen bietet. Oder will man auch dort Operetten geben? Bravo, Direktor Simons
Der Lärm war nötig, und er war gut inszeniert. Man wird schon begreifen; besonders, wenn die Durchschnittsvorstellungen so annehmbar sind wie gerade heuer.
Hofoper: Krisengerüchte. Sie sind selbstverständlich unbegründet. Niemand denkt daran. Alles schimpft. Auf einmal ist ein neuer Direktor da. Niemand hätte oben etwas gegen den Direktor Weingartner gehabt. Nur privater Klatsch war zu den Erzsittlichen gedrungen. Hierauf Verlegenheit. Ein 'grosser' Dirigent-Direktor ist nicht zu haben. Was tun? Der Rat einer berliner Konzertagentur ändert das 'System'. Aber nun wird der 'grosse' Kapellmeister gesucht. Und wenn sie ihn nicht gefunden haben, so suchen sie noch heute.
Volksoper: Frohlocken! Denn ein Zugstück hat sich eingestellt, wie noch nie, das Zugstück dieser Bühne. Vor ein paar Jahren, als sie noch Schauspielhaus war, hiess es: 'Im Zeichen des Kreuzes'. Jetzt heisst die Oper: 'Quo vadis?', nach dem Roman für Söhne und Töchter gebildeter Stände. Deutscher Text von dem wiener Kritiker Hans Liebstöckl, Musik von Nouguès. Die Wonne Frankreichs. Die Ausverkauftheit Währings. Es ist aber auch nicht zu spassen. Erstens brennt Rom, und der Kaiser Nero singt dazu (die Musik ist aber unschädlich). Zweitens versammeln sich die Christen unterirdisch, und der Apostel Petrus tritt auf und erzählt von der bekannten Erscheinung (und hier, unter dem grossen Eindruck der gar nicht kolportagehaften Legende, gewinnt selbst die Musik etwas Halt). Drittens ereignet sich, Verehrteste, der Kampf der verurteilen Christen mit den Tieren des Zirkus. Und hier tritt Herr Urus auf, ein wirklicher Athlet namens Grafl, Preisringer, Gewinner einer Meisterschaft. Donnerwetter, die Muschkeln! Niemand möchte, wie die Buben in meiner Vaterstadt sagen, "auf seine Gassen kommen". Die Weiblichkeit, ohnehin ergriffen, wird vollends gefangen. Die Schrecken dieser Szene multipliziert die Musik. Verwundete Blechbläser schnappen nach Atem. Schliesslich, aber das ist schon minder interessant, stirbt das Heidentum mit Gelassenheit. Man begreift, dass unsre Volksoper versorgt ist. Sie ist anständig genug, die Gunst der Zeit zu Besserem zu nutzen.
Hofoper: 'Götterdämmerung'. Neu inszeniert, wie es heisst: von Roller. Der hatte 1905 unter Mahler mit dem 'Rheingold' begonnen, 1907 erst, weil während des Mozart-Zyklus von 1906 kein Heller Geld zu haben war, die wundervolle 'Walküre' geschaffen, 1908 unter Weingartner den 'Siegfried' folgen lassen. Schon damals soll es nicht mehr nach seinem Willen gegangen sein, bevor er ausschied, hatte er noch die Skizzen der 'Götterdämmerung' abgeliefert. Was daraus geworden ist, sieht man aus einer Gegenüberstellung der Skizzen und fertigen Bühnenbilder im 'Merker'. Darüber wird die 'Schaubühne' noch mehr sagen, von der immer schönern und grössern Brunhilde der Mildenburg spreche ich unter andern Zeichen.
Volksoper: Die lange verschobene Oper des ersten Kapellmeisters, 'Kleider machen Leute', wird zum ersten Mal ausgeführt. Was Alexander von Zemlinsky für das musikalische Wien bedeutet, und wie insbesondere die Volksoper ohne ihn gar nicht zu denken ist, brauche ich nicht zu wiederholen. Aber er gehört auch als Komponist zu den Besten, die wir gegenwärtig haben. Die harmonischen und orchestralen Feinheiten seiner neuen Partitur sind überzeugend, und sie haben auch überzeugt, wiewohl Zemlinsky nichts von seiner viel verlästerten Modernität preisgegeben hat. Nun ist es aber eine komische Oper: darf man da von der leichtfasslichen Heiterkeit absehen? Ich musste immer wieder an den 'Barbier' von Cornelius denken, der es ja den Leuten auch nicht recht macht. Genau so hat man Zemlinsky, sagen wir es doch heraus, mangelnde Trivialität vorgeworfen. Aber warum zankt man dann mit der Operette? Komische Opern sind, mit Verlaub, keine Possen, und diese seldwyler Geschichte Gottfried Kellers wird noch dazu von einem sehr ernsten Schalk vorgetragen. Das grässliche Schneiderlein Strapinski ist kein Burleskenprinz, kein Casanova, zu dem man sich Offenbachs Weisen wohl denken könnte, nicht einmal einer von den Schicksalsverwandten bei Shakespeare. Wenn dieser romantische Jüngling als Graf bei seinem Nettchen die Illusion einer Heimat gefunden hätte, so hätte er alles gestanden, wäre er um des kurzen Glückes willen in den Tod gegangen. So die Novelle, und die Operndichtung von Leo Feld folgt ihr ja ziemlich genau und macht die Demaskierung des Grafen sogar glaubhafter, natürlich muss sie sich eine Menge schöner Motive Kellers entgehen lassen. Das ist der tiefere, der Musik vor allem zugängliche Sinn: dass Kleider wirklich Leute machen; dass sie und alles Zufällige am Menschen nur Schein sind; dass der wahrhaft Vornehme in allen Kleidern ein Graf ist und aller Liebe, jedes Glück wert; dass ihn aber so manche erst erkennen, wenn ihn nach seinen Kleidern alle Welt so interessant findet, wie es der polnische Aristokrat Strapinski aus der Familie der Krapülinski und Waschlapski wäre. Ich kann nur wünschen, dass diese Oper mit ihrem saubern, feinen Buch und ihrer prächtigen Musik von vielen Bühnen beachtet würde. Die Volksoper hat sie gut aufgeführt, aber etwas ungünstig angesetzt, als Weihnachten nahe war und schon Salome in allen Köpfen spukte. Entschliesst sich jetzt Stuttgart endlich zur längst geplanten Aufführung, dann ist mir um das Werk nicht bange, so wenig man je - ich will aber nicht vergleichen - den 'unpopulären' 'Barbier
vergessen wird.
Hofoper: Eben hält der düsseldorfer Schriftsteller Erich Eckertz einen mutigen Vortrag über die wiener Operettenpest. Es gibt einiges Aufsehen. Zu gleicher Zeit studiert die wiener Hofoper den 'Zigeunerbaron' ein. Sie ist jetzt sehr fleissig, und die Zeitungen haben mit Meldungen zu tun. Einen Tag geht auch der 'Dirigent' Weingartner, den andern Tag bleibt er. (Wenn er aber bleibt, wozu ist dann Krise gespielt worden? Der Regisseur Wymtal war doch schon vorher ausgeschieden. Wird nun einfach ein neuer Regisseur, den man Direktor nennt, kommen? Wird das alte Unheil, das Zweierlei der Orchester- [Orchesterleitung] und der Bühnenleitung aufrechterhalten bleiben?) Herr von Weingartner wird Generalmusikdirektor. Nein, am nächsten Tag wird er es schon nicht mehr. Er wird auch so bleiben. Nein, er ist wieder unentschieden. Rette sich wer kann! Einen Preis für eine Zeitung ohne neue Nachrichten! Jedesfalls arbeitet man jetzt für ein gutes Andenken. Und bringt den 'Zigeunerbaron'. Und setzt Pfitzners 'Armen Heinrich' wieder ab. Und lässt von 'Pelleas und Melisande' nichts mehr hören. Und der ewig versprochene 'Benvenuto Cellini' und der notgedrungene 'Rosenkavalier
sollen ihr Werk tun. Aber vor allem: der 'Zigeunerbaron' ...
Volksoper: Hier ist indessen, knapp vor Weihnachten, 'Salome
ausgebrochen. Allen Respekt vor dem Wollen und Gelingen; nur hätten einige Proben mehr sehr gut getan. Die zwanzigste Aufführung wird sicher viel besser sein als die erste. Aber man hatte eine sehr achtbare Salome, Fräulein Wenger, das Orchester unter Zemlinsky war auf einer erstaunlichen Höhe, und die Bühnengestaltung durch Alfred Roller von eindringlicher Farbenpracht. Zur Erklärung muss bemerkt werden, dass Mahler die 'Salome' bei der Hoftheaterzensur nicht durchzusetzen vermocht hatte, dass die Hofoper sie bis heute nicht geben darf, und dass Wien die Oper bis jetzt nur durch ein dreiwöchiges Gastspiel des breslauer Theaters vor einigen Jahren kennen gelernt hat. 'Salome' ist natürlich keine 'Volks'-Oper. Dass sie aber Direktor Simons aufführt, geschieht gewiss nicht blos der Sensation zuliebe, sondern, wie seinerzeit bei der 'Ariane' von Dukas, aus der richtigen Überzeugung von seinen Verpflichtungen auch typisch modernen Werken gegenüber. Und solche Taten sind immer sein schönster Lohn gewesen ... Doch da 'Salome' keine Volksoper ist, so musste man sie dem Volk erklären. In Wien besteht die Sitte, dass Tageskritiker solche Erläuterungen (selbst bei Operetten, wo doch der Stumpfsinn jeder Brücke spottet) der Theaterdirektion liefern, über deren Aufführungen sie zu Urteilen haben. Die Erläuterungen werden einem mit dem Theaterzettel übergeben; man ist also wehrlos. Wer Bekehrungen sucht, erfährt diesmal zum Beispiel, dass Oskar Wilde im Zuchthaus zu Dublin "sein Leben frühzeitig beschloss"; dass Flaubert ein französischer "Literat" war (der Urheber dieser Erläuterungen ist dafür ein deutscher Stilist); dass "die geniale Kompliziertheit der Partitur schon aus ihrer Besetzung zu ersehen ist"; dass Strauss das Heckelphon (daher der Name!) "erfunden" hat. Aber immerhin: 'Salome' ist auch dem Erläuterer ein Kunstwerk, was er in Sperrdruck setzt, und überhaupt: "Seine Lebensfähigkeit hat es ja zweifellos schon erbracht".
Hofoper: Sie hatte sich endlich besonnen und die 'Rose vom Liebsgarten', wenn auch ohne Energie, wieder aufgenommen. Sie hatte sich endlich erinnert, dass sie im vorigen Jahre mit Bittners 'Musikanten' einen grossen Erfolg gehabt hat. Und drei Tage nach der 'Salome' der Volksoper stattete das Hofinstitut mit seinen grossartigen Mitteln den 'Zigeunerbaron' aus. Johann Straussens zweites Werk (die Fledermaus ist schon hereingeflattert) wird die Hofoper nicht schänden. Aber es wird in einem Theater, in dessen äussern Rahmen es nicht passt, leiden müssen, und es hat schon gelitten. Und sein Erfolg war, mag es der Zettel auch komische Oper nennen, ein Operettenerfolg im Zeichen der Zeit; das ist das Schlimmste. Es ist nicht nötig, dass in den Tagen der Operettenserien und Serienoperetten die Hofoper in einer Woche zweimal die 'Fledermaus' und einmal den 'Zigeunerbaron' gibt; worauf eine Woche mit drei Aufführungen des 'Zigeunerbarons' folgt. Das heisst, dass man in zwanzig Jahren, wenn es so weiter geht, an der Hofoper die 'Lustige Witwe' aufführen wird. (Ich hätte gar nichts dagegen, wenigstens würde man es sich abgewöhnen, die grossen Geister alltagsmässig abzuleiern.) Um ja nicht missverstanden zu werden: von Zeit zu Zeit den 'Zigeunerbaron', wie früher die schon aufgenommene 'Fledermaus' - gerne
(Obwohl es da noch immer Unterschiede gibt, namentlich im Text.) Aber der 'Zigeunerbaron' als Sensationsrepertoirestück, als Rechtfertigung: das ist das Ende einer Direktion, deren Anfangsidealen Mahlers 'Fidelio
nicht genügt hatte! Dabei ist sie schön, diese Operette. Ihr Zauber ist für einen, der das Land kennt, zuerst der Zauber dieses bunten Süd-Ungarn mit seinen fernen Bergen und allzu nahen Zigeunern, feinen Schwaben, Serben, Magyaren, Rumänen, seinen Bauern, Dieben, Handwerkern, seiner Abgeschlossenheit: extra Hungariam non est vita. Wobei man sich für dieses Leben zehn Monate im Jahr schönstens bedankt. Zwei Monate möchte man es, wenn man es einmal gekostet hat, ganz gern mitmachen. Und die Musik! Wie das strömt und quillt! Die Leute - es waren, obwohl die Intendanz, auf die Sensation bauend, dreifache Preise vorgeschrieben hatte, immerhin Leute da - blickten einander an, wenn wieder ein solcher Walzer kam ... Die Herrschaften von Heute möchten es gern mit gestopften Trompeten, Harfenglissandi und ähnlichen Witzen machen, möchten ihre Effekte mit möglichst geringer Anstrengung und Erfindung nach den Grundsätzen eines Warenhauses in Halbasien kalkulieren, dann aber noch immer den Glauben erwecken, dass sie Kunst absetzen wollen. Nein, das gelingt nicht. Es war gar nicht sehr vorsichtig, ihnen den 'Zigeunerbaron' vorzuführen! Und man muss es Weingartner lassen: er war in seinem Element; fast als sollten wir ihn noch eigene Operetten dirigieren sehen. Die vielen verborgenen Schönheiten, die achtlos verworfenen Melodien, die unscheinbare und doch so feine Instrumentation fand dankbare Kenner, und das zweite Finale mit seinem Rakoczymarsch und seinem leider nicht getanzten Csardas heizte allen das Blut. An Pracht der Dekorationen und Aufzüge war nicht gespart worden; man hatte Frau Kurz die Saffi und Herrn Miller den Barinkay singen lassen, und es war alles sehr schön und gut und reichlich. Aber, aber, das Ganze wollte eben komische Oper sein und verlor seine derbe Fröhlichkeit, verlor seinen Schmiss, verlor selbst seinen Klang in dem grossen Haus. Nur Schrödter rettete den Ton und versuchte Girardi zu ersetzen, den man für gelegentliche Aufführungen ganz gut hätte gewinnen können. Der Schmiedechor wurde sogar wiederholt, was zu allerhand Bemerkungen über das Sparsystem der Hofbehörde, die einen Teil des Chors in eine Ausstandsbewegung getrieben hatte, gerechtfertigten Anlass gab. Hatte man sich doch "hochortigerseits" sogar mit der Aufführung 'chorloser
Opern fortwursteln wollen. Und was nun, wenn die Sensation wirkt? Welchem neuen Jahr, welcher neuen Zeit geht dieses Haus der ewigen Krisen, sein neuerungssüchtiges Publikum, geht dieses Volk des alten Neides, des ewigen Hasses, der ewigen Ungenügsamkeit entgegen? Lassen wir uns nicht die Laune verderben! In zwei Stunden kann man inmitten im Schnee sein. Das ist sicher der grösste Vorzug Wiens.
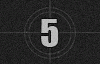
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.