Full Document
Das Land., 19.02.1913, S. 234-238
[Das Land. 19.2.1913, S.234-238 Das Lichtspiel auf dem Lande ...]
Das Land. 19.2.1913, S.234-238
Das Lichtspiel auf dem Lande (Kinematograph)
Vorführung und Erklärung eines Kinos.
Berichterstatter: F. Paul Liesegang, Düsseldorf
Meine verehrten Damen und Herren! Wenn wir uns heute abend programmgemäss mit dem Kinematographen und der Tätigkeit des Lichtspielapparates auf dem Lande beschäftigen wollen, so werden wir nicht darüber hinwegkommen, uns auch über die technische Seite kinematographischer Vorführungen zu unterhalten. Ich schlage vor, dass wir mit ein paar Schritten rasch den Entwicklungsgang der Kinematographie durcheilen, dann einen Blick in die Werkstatt tun, um die Wirkungsweise und den Bau des Apparates kennen zu lernen, dass wir uns dann etwas über die Unterkünfte und die Kinematographentheater unterrichten, um schliesslich überzugehen zur Tätigkeit des Kinematographen auf dem Lande, um zu hören, was da geschehen kann und bisher geschehen ist. Das sieht allerdings aus [etwas Text fehlt], aber ich glaube, dass wir auf den Schwingen des Lichtbildes doch noch darüber hinwegkommen.
Versetzen wir uns achtzig, ja neunzig Jahre zurück, da fragte der berühmte Gelehrte John Herschel den Mathematiker Babbage, mit dem er zu Tisch zusammensass, wie man es wohl anstellen könne, zwei Seiten eines Geldstückes zu gleicher Zeit zu sehen. Der andere zuckte die Achseln und da zeigte ihm Herschel die Lösung der scherzhaft gestellten Frage, indem er das Geldstück auf dem Tisch kreisen liess. Sie können den Versuch leicht nachmachen und sich von der Richtigkeit überzeugen. Ein paar Tage darauf erzählte Babbage einem befreundeten Arzt Dr. Friton diese Geschichte, und dieser stellte nun ein kleines Instrument her, mit dem sich der Versuch noch besser demonstrieren liess: es war die Wunderscheibe, die das erste Bild hier vorführt (Lichtbildvorführung). - Es ist eine runde Pappscheibe. Auf einer Seite sehen wir die Figur eines leeren Käfigs, auf der anderen einen Vogel. Wenn man die Scheibe in rasche Umdrehung versetzt, so sieht man den Vogel im Käfig sitzen. Diese Erscheinung wird bewirkt durch die Dauer des Lichteindruckes. Unser Auge lässt einen Lichteindruck, den es empfangen hat, nicht gleich wieder fahren, sondern hält ihn den Bruchteil einer Sekunde fest. Man kann diese eigentlich fehlerhafte Erscheinung des Auges demonstrieren mit Hilfe eines im Dunkeln geschwungenen glühenden Körpers. Ich will den Versuch einmal mit einer kleinen Glühlampe machen, die auf einer drehbaren Scheibe sitzt. Wenn ich die Scheibe langsam drehe, sehen Sie, wie das Lämpchen weiter geht; wenn ich sie aber schnell drehe, sehen Sie das Lämpchen bei der raschen Bewegung nicht mehr, vielmehr bekommen wir einen Lichtstreifen, der sich bei noch rascherer Bewegung zu einem Kreise schliesst.
Nun zurück zu der Zeit, wo die Wunderscheibe erfunden wurde. Das war Mitte der zwanziger Jahre. So einfach und unscheinbar die Wunderscheibe auch war, es war doch ein wichtiges Prinzip darin festgelegt, und die Erfindung gab zweifellos mancherlei Anregung. So lag nun das Problem in der Luft, mehrere Bilder in ähnlicher Weise zu kombinieren. 1832 wurde die Lösung an zwei Stellen gefunden. Professor Stampfer in Wien und Plateau in Genf konstruierten unabhängig von einander das "Lebensrad". Eine Ausführungsform des Lebensrades wird uns das nächste Bild zeigen: es ist eine runde Scheibe, woraus die Zeichnungen sitzen, welche eine sich bewegende Figur in mehreren Bewegungsmomenten darstellen, hier ist es ein Seilchen springender Junge.
Auf derselben Achse, fest damit verbunden, sitzt eine Blendscheibe. Wenn man nun die Scheibe dreht und zunächst direkt gegen die Bildscheibe sieht, nimmt man nichts von den Figuren wahr. Halten wir aber das Auge gegen die Blendscheibe, so bekommen wir rasch nacheinander, immer auf einen Moment, Bild um Bild zu sehen, und die Folge ist eine sich bewegende Figur. Man hat von diesem Lebensrade eine grosse Anzahl Abänderungen gemacht, von denen wohl die bekannteste die Wundertrommel ist.
Die Bilder, die man mit dem Lebensrade zeigte, waren naturgemäss zuerst gezeichnet. Erst anfangs der fünfziger Jahre konnte man dazu übergehen, die Photographie zur Herstellung der Bilder heranzuziehen. Aber die Hilfsmittel waren damals zur Herstellung einer raschen Folge von Momentaufnahmen nicht ausreichend. Wie man sich behalf, möge die folgende Bilderreihe zeigen, die aus dem Ende der fünfziger Jahre stammt. Jedes einzelne Bild davon musste durch eine Zeitbelichtung gewonnen werden. Die kaffeetrinkende Dame musste neunmal eine sorgfältig vorbereitete Stellung einnehmen und für jede Belichtung stillsitzen. Eine naturwahre Wirkung konnte dabei selbstverständlich nicht herauskommen.
Erst Ende der siebziger Jahre gelang es dem amerikanischen Photographen Muybridge unter Aufbietung gewaltiger Hilfsmittel, Reihenaufnahmen lebender Tiere zu machen. Er verwendete dabei eine Barriere von 24 Apparaten. Quer über die Bahn waren 24 Fäden gespannt, zu jeder Kamera einer, die das Tier zerreissen musste, und die Anordnung war so getroffen, dass beim Reissen des Fadens der Momentverschluss der betreffenden Kamera losging. Auf diese Weise wurden rasch nacheinander 24 Aufnahmen des Tieres gemacht. Ich kann Ihnen eine der besten Aufnahmen zeigen, die Muybridge herstellte. Er hat zu seinen Versuchen ungefähr eine halbe Million Platten verbraucht. - Diese Aufnahmen erregten seinerzeit grosses und berechtigtes Aufsehen, doch wurden die Resultate bald übertroffen durch Anschütz, der Mitte der achtziger Jahre nach ähnlichem Verfahren seine Arbeiten begann. Die Bilder waren so scharf und zeigten soviel Einzelheiten, dass sie auch die Vergrösserung vertrugen und sogar in dieser starken Vergrösserung noch gut wirkten. Die Bewegungsphotographie fand inzwischen eine bedeutende Förderung in Frankreich durch den Pariser Physiologen Marey. Dieser interessierte sich zunächst für das Studium des Vogelfluges, und da die Anordnung von Muybridge hierzu nicht ausreichte, ging er selbst an die Konstruktion geeigneter Apparate. Sein erstes Modell, die photographische Flinte vom Jahre 1882, werden wir im folgenden Lichtbilde sehen. Mit diesem Apparat konnten 12 Aufnahmen in der Sekunde gemacht werden. Die Platte hier zeigt eine solche Reihe: sie gibt den Flug einer Möwe in 12 Momenten wieder. Die Bilder waren aber sehr klein, nur ein Zentimeter gross und ohne jedes Detail.
1888 ging Marey nach vielen versuchen und andren Konstruktionen zur Verwendung von Negativbändern über, die ruckweise durch die Kamera gezogen wurden, und schuf damit als erster einen Apparat, der unseren heutigen kinematographischen Aufnahmekamera entspricht.
Das folgende Bild zeigt uns ein Stückchen aus solcher Aufnahme, die Marey mit dem neuen Apparat herstellte. Der Fortschritt war ein enormer. Während Muybridge und Anschütz, um 24 Bilder zu machen, 24 Apparate brauchten, kam Marey mit einem einzigen Apparat aus, ja die Zahl der Bilder war bei ihm nur begrenzt durch die Länge des Negativbandes. In jene Zeit fällt die Einführung des Zelluloidfilms, der ein weitaus besseres Material darstellte als das Negativpapier und der nun eine rapide Entwicklung der Kinematographie herbeiführte. Wir wollen uns auf die Einzelheiten in der weiteren Entwicklung nicht einlassen, sonst würden wir uns den ganzen Abend darüber unterhalten müssen.
Wie der kinematographische Apparat arbeitet, können wir uns am besten klarmachen, indem wir eine Filmkamera, einen Kodak, in die Hand nehmen. Da haben wir links das Filmband, das auf einer Rolle sitzt und von dort zu einer zweiten Rolle geführt ist, worauf es sich, wenn man die Rolle dreht, aufwickelt. Vorn haben wir das Objektiv und dahinter die Verschlussscheibe. Wir wollen nun eine Aufnahme machen. Dazu geben wir der Verschlussscheibe eine Umdrehung; es bewegt sich dann die Öffnung am Objektiv vorbei und verursacht eine Belichtung. Es soll nun ein zweites Bild gemacht werden. Dazu müssen wir den Film durch Drehen um ein Stück so gross wie das belichtete Bild weiter bewegen. Wenn das geschehen ist, geben wir der Verschlussscheibe wieder eine Umdrehung. Ein drittes, viertes, fünftes usw. Bild erfordert immer wieder dieselben Handgriffe: zuerst muss jedesmal die Rolle ein Stück weitergedreht werden, dann bekommt die Verschlussscheibe eine Umdrehung. Denken Sie sich beide Handgriffe durch einen Mechanismus ausgeführt, so haben Sie den kinematographischen Aufnahmeapparat. Der belichtete Film wird auf einen Rahmen gespannt und dann ebenso wie der Kodakfilm entwickelt, fixiert, ausgewaschen und getrocknet.
Von dem Negativfilm wird durch Kopieren der Positivfilme gewonnen. Die Filmbänder sind an beiden Seiten mit Löchern versehen: auf jedes Bild kommen vier Löcher. Diese Perforation, die von Edison eingeführt wurde, ist erforderlich, damit der Mechanismus den Film sicher und genau transportieren kann. Das Filmband ist 3 1/2 cm breit, jedes Bildchen darauf ist 2 1/2 cm breit und 2 cm hoch. Ein Bild sieht beinahe aus wie das folgende; erst wenn man eine Reihe von Bildern überblickt, sieht man den Unterschied, der durch die veränderte Stellung der sich bewegenden Figuren hervorgerufen wird. Und das ist kein Wunder, kommen doch 15 bis 20 Aufnahmen auf die Sekunde; das macht auf die Minute rund 1000 Bilder, auf die Minute bekommen wir also ein Band von 20 Metern. Ein Film von 100 Meter Länge läuft in 5 Minuten ab.
Wir wollen nun verfolgen, wie mit Hilfe des Filmbandes, dessen Herstellung wir eben beobachteten, die Wiedergabe als lebendes Lichtbild bewirkt wird. Wir brauchen dazu eine Einrichtung, die im grossen und ganzen der "Laterna magica" oder vielmehr dem verbesserten Projektionsapparat entspricht. Links ist das Gehäuse mit der Lichtquelle; in der Vorderwand sitzen zwei Linsen, welche die Lichtstrahlen durch das transparente Bild in einem Kegel ins Objektiv werfen; letzteres leitet die Strahlen derart gegen den Schirm, dass dort ein vergrössertes, scharfes Lichtbild entsteht.
Diesem Vorgang, den wir hier gerade anwenden, nennt man Projektion. In diesen Strahlengang bringen wir nun unser Filmband und zwar so, dass zunächst das erste Bildchen projiziert wird, und dann müssen wir den Film genau so weiterbewegen, wie vorher in unserem Kodak, den wir uns mechanisch betrieben dachten; jedes Bildchen bleibt einen Augenblick stehen, springt weiter, bleibt wieder stehen, springt wieder weiter und so fort; die Verschlussscheibe brauchen wir auch hier, denn sie muss das Weiterrutschen der Bilder verdecken.
Wir können uns den Vorgang mit Hilfe des Apparates, den ich hier stehen habe, veranschaulichen. Wir haben einen Film eingespannt. Ich werde den Apparat zunächst langsam drehen, damit Sie das Stillstehen des Bildes, das Weiterrutschen, überhaupt die einzelnen Vorgänge verfolgen können. - Sie sehen auf dem Schirm ein Lichtbild. Ich drehe. Da sehen Sie: Bild - dunkel - Bild - dunkel - Bild - dunkel usw. Nun werde ich die Verschlussscheibe abnehmen. Da nehmen Sie auch das Weiterrutschen wahr. Nun lege ich die Blendscheibe wieder auf und drehe rasch und rascher: jetzt verschwimmen die Bilder ineinander, wir bekommen ein einziges Bild mit Bewegung.
Unter den verschiedenen Konstruktionen wird am meisten angewandt das Malteserkreuz. Der Film läuft um eine Zahntrommel, die mit ihren Zehen in die Löcher eingreift; dadurch wird das Filmband gezwungen, alle Bewegungen der Trommel mitzumachen. In das Malteserkreuz arbeitet eine Eingriffsscheibe mit einem Stift, der ihm beim Eingreifen jedesmal eine Viertelumdrehung erteilt. Ich habe ein kleines Modell einer solchen Einrichtung mitgebracht; wir wollen es auf die Wand werfen. Sie sehen da einen Zahnkranz, der die Trommel darstellen soll; darüber läuft das Filmband. Links haben wir die Eingriffsscheibe mit dem Eingriffsstift. Wenn die Eingriffsscheibe gedreht wird, steht die Trommel mit dem Film eine Zeitlang still; plötzlich aber wird die Zahntrommel herumgeworfen und gleichzeitig der Film hier ein Bildchen weiter bewegt. Sie müssen sich denken, dass das in Wirklichkeit viel rascher vor sich geht, damit wir 16 Umdrehungen in der Sekunde haben. Eine andere Konstruktionsanordnung, der Schlägerapparat, ist hier in perspektivischer Ansicht wiedergegeben. Wir sehen, wie der Film durch den Apparat hindurchläuft. Hier ist die Belichtungsstelle, hier das Objektiv, unten der Schläger und schliesslich die Aufwickelspule.
Im nächsten Bild haben wir einen grösseren leistungsfähigeren Apparat, der mit dem Malteserkreuz ausgerüstet ist. Wir sehen da eine Vorrichtung, die dem Regulator einer Dampfmaschine entspricht und die mit einer Klappe verbunden ist. Diese Einrichtung hat folgenden Zweck: Das Filmband besteht aus Zelluloid, einem Material, das leicht in Entzündung gebracht werden kann. Wenn nun die heissen Lichtstrahlen des Projektionsapparates Zeit haben würden, auf das Filmband aufzutreffen, solange der Apparat in Ruhe steht, so besteht die Gefahr, dass der Film in Brand gesetzt wird. Infolgedessen hat man die Klappe angebracht, die beim Stillstand des Werkes die Strahlen absperrt. Sobald man aber den Apparat in Betrieb jetzt, wird die Klappe durch den Regulator gehoben, um wieder zu fallen, sobald der Apparat steht. Der Antrieb der Theaterapparate erfolgt durch einen Elektromotor, denn das Drehen mit der Hand würde zu ermüdend sein..
Die grossen Filmfabriken besitzen zur Darstellung der szenischen Films grosse Glashäuser. Hier sehen wir ein solches Atelier. So ist staunenswert, was da alles ausgeführt und photographiert wird. Sie haben wohl schon Sachen gesehen, die verblüffend wirken und die Frage nahegelegen, wie das gemacht wird. Da gibt es z. B. ein Stück, wo ein Mann an den Wänden hinaufkriecht und an der Decke hinläuft oder dies Kunststück sogar mit dem Fahrrad ausführt. Die Lösung ist einfach. Auf den Boden des Ateliers werden abwechselnd Dekorationen gelegt, welche Decken und Wände eines Zimmers darstellen. Der Mann kriecht und läuft oder fährt mit dem Rade darüber und wird von oben her photographiert. Die Täuschung ist sehr vollkommen.
Sehr beliebt sind die Tricks, bei denen Personen verwandelt werden. Das nächste Stück zeigt ein kurzes Stück einer solchen Szene, in der sich eine alte Bettlerin oder eine Hexe in eine Fee verwandelt. Dazu wurde einfach an der betreffenden Stelle die Aufnahme unterbrochen. Die Person zieht ein anderes Gewand über oder wird durch eine andere Person ersetzt, die natürlich genau dieselbe Stellung einnimmt, der Photograph öffnet wiederum das Objektiv und dreht weiter.
Noch ein anderes Beispiel! Der Kinematograph führt folgende Szene vor: Ein Betrunkener liegt auf der Strasse, ein Automobil saust heran und fährt ihm beide Beine ab. Er schreit dem Automobil nach und schwingt die Beine in der Luft. Das Automobil hält an, der Insasse läuft heran und flickt dem Verunglückten die Beine wieder an. Der Überfahrene steht auf, ist geheilt, und beide ziehen zufrieden voneinander. Auch hier wird die Aufnahme unterbrochen und zwar zweimal: einmal in dem Moment, wo das Automobil herangekommen ist. Der Betrunkene wird durch einen Krüppel ersetzt, und es werden ihm künstliche Beine vorgelegt. Wenn dann das Automobil das Unheil angerichtet hat und die Beine angeflickt sind, tritt der erste Mann wieder an die Stelle.
Von diesem Hilfsmittel der Aufnahmeunterbrechung wird häufig Gebrauch gemacht. Der Film, geduldig wie er ist, reiht Bild an Bild auf, wie und wann es dem Photographen beliebt. Und das Publikum bekommt nachher die Bilder in sausender Folge vorgeführt; es merkt nicht, dass der Kinematograph eigentlich lügt, dass er ganze Strecken zwischen einzelnen Bildern weglässt. Kein Wunder, dass ihm die Dinge zauberhaft erscheinen.
Da gibt es die tollsten Sachen zu sehen: Tote Gegenstände führen einen Tanz auf; Streichhölzer spazieren aus der Dose und bauen sich zu Figuren auf; Bleisoldaten marschieren auf und liefern eine Schlacht.
Die Hilfsmittel des Kinematographen sind damit nicht erschöpft. Aber ich glaube, es ist genug damit. Man soll in diesen Kunststücken nicht die Hauptbedeutung des Kinematographen suchen.
Ausserordentlich grossen Wert hat der Kinematograph für Naturwissenschaft und Technik. In der Hand des Naturfreundes ist der Kinematograph ein grosser Forscher geworden. Er schaut durch das Vergrösserungsglas und verfolgt das Treiben der kleinen Lebewesen; er belauscht die Vögel in ihren Nestern; er beobachtet die Pflanzen und Blumen, wie sie werden und vergehen; er sucht fremde Länder und Völker auf und studiert ihre Sitten und ihren Sinn; oder er geht mit einem Techniker in die grossen industriellen Werke. Er schreibt alles auf den Film auf, nichts entgeht ihm, und so oft man will, setzt er alles wieder in eine Lichtbilder-Wirklichkeit um und erzählt es wieder bis in die kleinsten Einzelheiten. So steht uns durch den Kinematographen die ganze Welt offen. Alles, was der Mensch geschaffen, was die Welt im grossen und kleinen darbietet, bringt der Wunderapparat vor unser Auge in einer Stunde mehr, als mancher nach langem schwierigen Studium beobachtet oder auf einer weiten grossen Reise gesehen hat.
Praktische Anwendung hat der Kinematograph hauptsächlich im Kinematographen-Theater gefunden. Deren Zahl ist auf etwa 30000 zu schätzen; davon kommt ungefähr die Hälfte auf Amerika, während Deutschland nicht ganz 3000 beherbergt. An die 100 Filmfabriken arbeiten dafür und schaffen Tag für Tag gegen 600000 Meter Films mit einem Verkaufswert von ungefähr 1/2 Million Mark.
Der grossen Nachfrage entsprechend werden hauptsächlich Dramen hergestellt und zwar vielfach möglichst sensationelle. Der Theaterbesitzer, der ein Geschäft mit seinem Theater machen will, sieht, dass die Schauerdramen das Haus füllen; der Filmverleiher, ebenfalls ein Geschäftsfreund legt sich hauptsächlich solche Programms an, die ihm viele Kunden sichern. Und die Filmfabrik, die grosse Dividenden verteilen will, sucht ihre Konkurrenz durch möglichst kräftige Schlager zu übertrumpfen, um möglichst viele Exemplare von dem betreffenden Schlager an die Verleiher loszuwerden. Die Zensur kann Übergriffen wohl ein Ziel setzen, aber die Tendenz nicht ändern. Schundfilms! Unter diesem Zeichen hat eine kräftige Bewegung gegen den Kinematographen eingesetzt, nicht gegen den Kinematographen an sich, vielmehr gegen die Kost, die in den Theatern dem Publikum vielfach vorgesetzt wird. Aber mit dem Protest allein ist es nicht getan; nur Taten können Besserungen schaffen. Wie man die Schundliteratur am wirksamsten in der Weise bekämpft, dass man dem Volke gute Bücher billig zugänglich macht, so gilt es auch hier, die gepfefferte Speise der Schauerdramen durch kräftige, gesunde, aber doch schmackhafte Nahrung zu ersetzen.
Was ist da bisher geschehen? Idealisten versuchten schon vor Jahren die Theaterbesitzer zu beeinflussen, nur einwandfreie Bilder vorzuführen. Wo das wirklich einmal gelang, blieb der Erfolg aus. Waren die Speisezettel der Reformer zu klein? War die Kost zu streng? Hatte das Publikum noch keinen Sinn für solche Sachen? Oder waren die Eintrittspreise zu hoch? Kurz und gut, das Volk lief ins Haus nebenan; der Zug nach dem Schauerdrama riss alles hinweg. Und wo damals ein Theater stand, da standen bald sechs oder mehr. Wiederum suchte man Fühlung. Der Theaterbesitzer war jetzt zugänglicher und an vielen Stellen kam es zu einer Verständigung. Es wurden Schülervorstellungen eingerichtet, die sich ja an einigen Stellen gut bewährten, an andren leider eingingen. Damit ist etwas geschehen, aber nicht genug. Mutige Vorkämpfer fassten den Entschluss, auf eigene Faust ein Kinematographen-Theater aufzutun. Da galt es, nur einwandfreie Films vorzuführen und die Darbietungen dem Volke möglichst billig zugänglich zu machen. Das von Professor Dr. Sellmann in Hagen begründete Kinematographen-Theater nimmt 10 Pfg. für Kinder und 200 Pfg. für Erwachsene. Mit so niedrigen Eintrittspreisen kann ein Theater allerdings kaum bestehen, und es ist eine Beihilfe der Gemeinde erforderlich. Dem wackeren Beispiel folgend sind auch schon Gemeinden dazu übergegangen, Kinematographen-Theater zu eröffnen: sie werden zweifellos noch viele Nachahmungen finden.
Wie steht es nun auf dem Lande? Wo Gelegenheit dazu ist, strömt die Landbevölkerung Sonntags in Scharen in die Stadt, und da ist der Hauptanziehungspunkt das Kinematographentheater. Namentlich die Jugend ist vom Kinematographenfieber angesteckt. Manch kleiner Ort beherbergt ein oder zwei Kinematographentheater, die, auf die Landbevölkerung rechnend, nur Sonntag oder noch Samstag nachmittags spielen.
Wie kann man auf dem Lande diesen mächtigen Kinematographenhunger stillen? Auch da ist mancherlei geschehen und sind vielerlei Erfahrungen gesammelt worden, auf Grund deren man weiter bauen kann. Da hat man vor allem Wanderkinematographen an vielen Orten eingerichtet. Vorgegangen sind z. B. die Gesellschaft zur Verbreitung der Volksbildung in Berlin, die Lichtbilderei in München-Gladbach (1), der Bayerische Bauernverein in Regensburg und neuerdings die Düsseldorfer Regierung. Die Apparate werden aufs Land hinausgeschickt, um dem Volke daheim gute und schöne Sachen gegen geringes Geld oder gar umsonst zu zeigen. Ein Wanderkinematograph für jeden Kreis! Das wäre wohl das Ideal. Darüber hinaus sollten die grösseren Landgemeinden die Anlage eines Standkinematographen in den für die Jugendpflege bestimmten Häusern ins Auge fassen.
(1) Die Lichtbilderei in München-Gladbach gibt eine Fachzeitschrift "Bild und Film" heraus, welche sich in den Dienst der kinematographischen Reformbestrebungen steht und deren Abonnement Interessenten empfohlen sei.
Wir wollen uns nun mit der Einrichtung eines Wanderkinematographen etwas näher befassen. Was gehört dazu? Zunächst der Apparat mit dem notwendigen Zubehör: Lampe, Schirm usw., zweitens ein Grundstock von Bildern. Der Apparat sollte besonders an den Plätzen, wo die Bevölkerung durch gute Vorführungen in der benachbarten Stadt verwöhnt ist, recht leistungsfähig sein, sonst heisst es: was da gezeigt wird, ist nichts, das sehen wir in der Stadt besser.
Zweitens soll der Apparat so gebaut sein, dass man auch Glasbilder damit projizieren kann; denn die Verbindung von Films und Glasbildern ist sehr nützlich. Drittens muss der Apparat so eingerichtet sein, dass er in jeder Gemeinde gebraucht werden kann, dass er z. B. nicht nur für elektrisches Licht benutzbar ist. Ferner muss die Lichtquelle sehr kräftig sein und helle Bilder liefern. Da kommen nur in Betracht elektrisches Bogenlicht und Kalklicht. Kalklicht kann im Anschluss an Leuchtgas gebraucht werden oder auch ohne Leuchtgas arbeiten.
Was kostet eine solche Einrichtung? Nehmen wir zunächst einen Apparat, der mit einem Stadtapparat konkurrieren kann und der sowohl mit elektrischem Bogenlicht ausgerichtet ist als auch mit Kalklicht. Eine solche Einrichtung kommt immerhin auf rund 1500 Mk. Nehmen wir einen billigeren Apparat, nur für Kalklicht eingerichtet, so kommen wir auf etwa 500 bis 600 Mk. Nun die Bilder! Neue Films anzuschaffen, ist recht teuer. Die kommen pro Meter auf 1 Mk., für eine Szene, die fünf Minuten dauert, würden das 100 Mk. sein. Man kann aber gebrauchte Filme, die in Kinematographentheatern abgelaufen sind, verhältnismässig billig aufkaufen, muss aber dann gut erhaltene und geeignete Sachen aussuchen. Da muss man Geduld haben, denn es sind Gelegenheitssachen. Legt man für Films und Glasbilder vorerst einen Betrag von 500 Mk. an, so stellt sich die ganze Einrichtung auf 1000 bis 2000 Mk., je nach der Ausstattung und Leistung. Wo schon eine Lichtbildzentrale ist, würde man die Beschaffung der Glasbilder sparen, und unter Umständen fällt dort auch die Beschaffung eines Apparateteiles weg, indem der vorhandene Lichtbilderapparat durch einen Kinematographmechanismus ergänzt werden kann.
Nun kommt ein wichtiger Punkt: die Bedienung des Apparates. Man kann einen solchen Apparat nicht hinausschicken wie ein Buch, auch nicht wie einen gewöhnlichen Lichtbilderapparat, mit dem ein geschickter Mensch nach guter Anweisung immerhin rasch fertig wird. Es wird wohl nicht an Leuten fehlen, die Kinematographen bald zu bedienen imstande wären; aber sich darauf zu verlassen, wäre doch immerhin gewagt. Nicht nur die Veranstaltung kann missglücken, sondern es kann auch grosser Schaden angerichtet werden. Der eine wird die ganzen Films zerkratzen oder gar in der Perforation zerreissen, ein anderer setzt die Films womöglich in Brand, indem er Lichtstrahlen darauf wirken lässt, oder ein Unbeteiligter benutzt die Filmdose als Aschbecher. (Heiterkeit)
Es ist alles schon vorgekommen, meine Herren! Es kann so ein nicht ganz unbedenklicher Brand, ein beträchtliches Schadenfeuer angerichtet werden. Ein ganz Schlauer doktert am Apparat herum und beschädigt womöglich den Bewegungsmechanismus. Kurz und gut, über diese Schwierigkeiten muss man sich klar werden; denn wenn man ohne eine fachgemässe Bedienung den Apparat hinausschickt, wird man unbedingt die schlechten Erfahrungen machen, die andere auch gemacht haben. Es gilt also die Forderung, dass zu dem Apparat ein Gehilfe ausgebildet wird, und zwar ein möglichst praktisch veranlagter. Es wird sich in jedem Orte wohl jemand finden, der Lust hat und dazu taugt. Er muss den Apparat innen und aussen kennen lernen und muss gewissermassen zum Inventar des Wanderkinematographen gehören. Die Betriebskosten werden dadurch allerdings teurer, aber die Veranstaltungen erhalten so eine sichere Grundlage.
Nur ein Wort über das Programm! Es ist nützlich, wenn man ausser Folge einige Glasbilderreihen hinzu nimmt. Die Verbindung ist insofern praktisch, als die Vorführung dadurch mehr Ruhe bekommt und eine gewisse Erholung dadurch hineingetragen wird. Für die Leute, die den Tag über gearbeitet haben, würde es zu anstrengend sein, den ganzen Abend nur lebende Bilder zu sehen; es würde ermüden. Ausserdem wird bei der Einteilung in Glasbilder und Films die Einrichtung auch billiger.
Es kommt noch ein wichtiger Punkt hinzu. Man sollte nicht nur die Glasbilder erläutern, sondern auch die kinematographischen Vorführungen. Es gibt viele lehrhafte Films, die erst ihren richtigen Wert erlangen, wenn eine sachgemässe Erklärung damit verbunden ist. Denken Sie, wir gehen in eine Maschinenfabrik, in einen grossen Betrieb und besichtigen z. B. eine komplizierte Webereimaschine. Wir werden von allen Seiten herantreten können und sehen, was sie leistet. Aber ihre Wirkungsweise werden wir schwerlich verstehen, wenn uns nicht ein Fachmann die Erklärungen abgibt. Dieselbe Sache werde nun hier im Bild vorgeführt, und da sollen wir dann an Hand der paar Titelworte aus den bildlichen Darstellungen klug werden! An den Erläuterungen fehlt es noch sehr viel. Wo man sachgemässe Erklärungen einmal eingeführt hat und dies ordentlich geschehen ist, da haben sie sich ausgezeichnet bewährt.
Wir kämen nun zu dem geschäftsmässigen Betrieb. Da wird man zu überlegen haben, wie weit die Zentrale den Abnehmern entgegenkommen kann. Wird sie den Apparat und die Bilder unentgeltlich zur Verfügung stellen? Wird sie nur die Transportspesen für den Apparat und die Kosten für den Vorführer berechnen oder wird sie eventuell dafür Beihilfen leisten? Oder aber wird sie gezwungen sein, für den Apparat und Bilder Miete zu erheben? Das wird von Fall zu Fall festzustellen sein. Sicher aber erfüllt der Kinematograph am besten seine Aufgabe, wenn er den Leuten möglichst wenig kostet. Man wird je nach dem Umfang und den Verkehrsverhältnissen möglichst darauf dringen, dass der Vorführer noch am selben Abend nach hause fahren kann, damit nicht unnötige Kosten für seine Unterkunft entstehen. Namentlich in grösseren Bezirken wird man auch Rundreisen des Apparates einrichten. Die Interessenten werden Fragebogen erhalten, die sie bei der Bestellung des Apparates ausfüllen müssen und die etwa 14 Tage vorher eingeschickt werden sollen. Darauf steht, ob elektrischer Strom vorhanden ist, welcher Art er ist, welche Spannung, welche Stromstärke vorhanden ist usw., wann und wo die Vorstellung stattfinden soll, welche Bilder gewünscht werden und welche Films. Dann wird man nach dem Vorbilde der Düsseldorfer Regierung vielleicht darauf hinweisen,, dass man mit einer einzigen Lichtbilderserie auskommt und mit drei bis fünf Films. Es wird gerade im Anfang häufig darin gesündigt, dass man den Leuten zuviel bietet, und dadurch den Eindruck zerstört.
Wenn einmal Stand- und Wanderkinematographen auf dem Lande eingeführt sind, so können sie auch andere Aufgaben erfüllen. Angenommen es würden kinematographische Aufnahmen von vorbildlichen landschaftlichen Betrieben gemacht - was könnten die Landbewohner davon lernen, Alte und Junge! Eine andere Aufgabe: man könne den Apparat benutzen, um die Landjugend mit den Gefahren der Grossstadt bekannt zu machen und andererseits den Städtern ein besseres Verständnis für das Land beibringen. Vielleicht ist der Kinematograph einmal berufen, hier Aufklärung nach beiden Seiten hin zu schaffen und dann auch vielleicht mitzuwirken, die Gegensätze, die da bestehen, auszugleichen. (Lebhafter Beifall)
Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Vortragenden sehr für die praktischen, aus seiner eigenen Erfahrung gewonnenen Anregung, die dazu beitragen werden, die Kinematographen immer mehr in den Gemeinden und sonstigen Verwaltungen von Stadt und Land einzuführen.
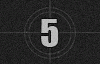
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.