Full Document
Frankfurter Zeitung, 10.05.1912, 30.05.12, 31.05.12, 01.06.12
Vom Werte und Unwerte des Kinos
Überall steht die Frage nach dem Werte und Unwerte des Kinos auf der Tagesordnung. Parlamente, Behörden, Schulen, Verbände beratschlagen Massnahmen, um die sich so ungeheuer schnell ausbreitende neue Art der Volksunterhaltung in ihren richtigen Grenzen zu halten. Im Vordergrunde des Interesses steht das Problem der Konkurrenz zwischen Theater und Kino und sie ist auch für die Frage nach dem Werte und Unwerte des Kinos von entscheidender Bedeutung. Um zu einer für beides gültigen Antwort zu kommen, wird es gut sein, die Vorfrage zu beantworten. Welche kulturelle Mission erteilen wir dem Theater? Man darf sich da nichts vormachen: ein grosser Teil des Publikums - und zwar nicht nur die Besucher der obersten Ränge, sondern auch die Inhaber der besseren Plätze - geht nicht ins Theater, um künstlerische Erlebnisse zu haben, sondern um sich zu unterhalten oder sich Sensationen zu verschaffen. Und man könnte daraus folgernd sagen: die Fähigkeit, Kunst um ihrer selbst willen zu geniessen, setzt so sehr einen durchgebildeten Geschmack, eine gleichsam gesättigte innere Kultur voraus, Kunst ist so durchaus nur eine Angelegenheit der geistigen Elite des Volkes, dass es schliesslich gleichgültig ist, auf welche Art die grosse Masse ihre scheinbaren Bedürfnisse nach Kunst - in Wahrheit ihre Vergnügungs- [Vergnügungs-Bedürfnisse] und Sensations-Bedürfnisse - befriedigt. Die Konsequenz dieses Gedankenganges ist auf der einen Seite das Theater der Fünfhundert, das intime Theater einer geistigen Aristokratie, auf der anderen Seite: Variété, Posse, Zirkus, Kino.
Es genügt, diese Sätze hinzuschreiben, um zu erkennen, welchen Gefahren die Kunst ausgesetzt ist, wenn sie aufgibt, in ihrem Wirkungsradius eine nationale Angelegenheit zu sein, wenn sie sich darauf beschränkt, ästhetische Werte einer relativ kleinen Gemeinde, der sie im übrigen auf ihr wirkliches Kunstverständnis hin auch nicht Herz und Nieren prüfen kann, zu übermitteln. Wir glauben, dass gerade die stets erneuten Versuche, breiteste Schichten der Bevölkerung für die Kunst zu gewinnen, wir glauben, dass die dauernde Reibung zwischen dem Künstler und der heute noch unverständigen, morgen vielleicht schon verständnisvolleren Menge der Kunst die für eine dauernde Lebensfähigkeit notwendige Kraft gibt. Man mag das Theater in seiner heutigen zwitterhaften Form für ungeeignet halten, weiter als ästhetische oder "moralische Anstalt" zu wirken; man wird aber nicht leugnen können, dass es an sich, gerade in unserer Zeit, neben dem gedruckten Wort in Buch und Zeitung, die beste Möglichkeit bietet, ideelle Werte dem Volke zu übermitteln. Glaubt man an diese kulturelle Mission des Theaters nicht, dann hat es keinen Sinn, sich über die Konkurrenz, die die Theater durch die Kinos erfahren, aufzuregen. Dann hat die Frage: Kino und Theater nur Interesse als rein wirtschaftliche Machtfrage, die zwischen beiden Gruppen ausgefochten werden muss.
Wir glauben aber, diese kulturelle Mission des Theaters bejahen zu müssen. Wir glauben, dass trotz mancher Dekadence-Erscheinungen im Theaterbetrieb, trotz der Überwucherns der seichten Ware, das Theater die Rolle, die ihm in der Geschichte der Menschheit zugewiesen ist, noch nicht zu Ende gespielt hat. Es steckt ein tiefer Sinn darin, dass ein Volk sich in seinen grossen Dichtern seine inneren und äusseren Schicksale, seine Natur und seine Geschichte immer wieder neu zu deuten versucht. Und wir möchten - scheinbar paradox - behaupten, dass das Bewusstsein, grosse Dichter zu besitzen und sie immer wieder durch Aufführungen ihrer Stücke lebendig zu besitzen, für ein Volk fast ebenso wichtig ist, wie diese Dichter und ihre Dichtung zu kennen. So meinen wir, dass, selbst wenn man sich den kunsterzieherischen Problemen gegenüber skeptisch und pessimistisch verhält, man doch das Theater und zwar das auf breiten Schichten ruhende Theater braucht. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter: wir glauben, dass die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, die man bei volksbildnerischen Bestrebungen gemacht hat, zu dem Schluss berechtigen, dass das Volk auch in den Schichten, die bisher den künstlerischen Werten gänzlich fern gestanden haben, durchaus bereit ist, Kunst auf sich wirken zu lassen, dass z. B. die Neulands-Empfänglichkeit der intelligenteren Schichten der Arbeiterschaft für eine Erziehung zur Kunst sogar hoffnungvolleres Material liefert als gewisse durch Halbbildung irre geleitete Teile der mittleren Bevölkerungsschichten.
Und von diesem Gesichtspunkt aus, von diesen Möglichkeiten des Theaters aus, an der künstlerischen und sittlichen Erziehung des Volkes mitzuarbeiten, müssen wir das Kino als eine ernsteste Gefahr, als eine die Entwicklung des Theaters verhängnisvoll beeinflussende Konkurrenz ansehen. Hat man die Berechtigung des Theaters als Kunststätte anerkannt, hat man andererseits die Gefahren erkannt, die in der Geschmacksverringerung durch das Kino für das Theater erwachsen, so ist es Pflicht, nach Mitteln auszuschauen, wie dem abzuhelfen sei. Doch bevor diese Mittel erörtert werden, mag es gut sein, sich noch einmal die oft behandelten Eigenschaften des Kino zusammenzustellen, die es zu einer ernsthaften Konkurrenz für das Theater zu machen scheinen. Dass diese besteht, mögen die beiden Feststellungen erhellen, dass im letzten Jahre 22 Theater in Deutschland, in Österreich 29 Theater, durch diese Konkurrenz zu Grunde gerichtet wurden.
Die Vorteile des Kinos gegenüber dem Theater beruhen in der bequemen und zweckmässigen Aufmachung. Die Kinos liegen zumeist parterre, in lebhaften Verkehrsstrassen. Arbeiter und Angestellte passieren sie auf dem Wege nach Hause. Dann: die Art der Spielzeit. Die Vorstellung findet während vieler Stunden mit in bestimmten Intervallen wechselndem Programm statt. Man ist an keine feste Stunde gebunden, kann jederzeit eintreten und jederzeit das Haus verlassen. Dazu kommt ein wirtschaftlicher Faktor: die Billigkeit. Sind nun diese Gesichtspunkte für die Konkurrenzfrage allein ausschlaggebend? Wir vermuten, dass namentlich in den Grossstädten nur ein geringer Teil der Kinobesucher auch Theaterbesucher sind. Es tritt aber hier neben die direkte eine indirekte noch verhängnisvollere Konkurrenz. Und zwar: Ähnlich wie durch die Schundliteratur wird durch das Kino ein niedriges Geschmacksniveau so festgehalten, dass sich der ursprünglich neutrale Geschmack durch Gewöhnung allmählich in Ungeschmack verwandelt. Es ist darum nötig, das Kino-Problem nicht nur vom Standpunkt der direkten wirtschaftlichen Konkurrenz für die Theater zu betrachten, sondern das Problem von einem weiteren volks-erzieherischen Standpunkte aus so zu stellen: Wie wirkt das Kino auf den künstlerischen und sittlichen Geschmack der Menge?
Von Kino-Enthusiasten wird häufig darauf hingewiesen, wie wertvoll das Kino für die Erziehung des Volkes sei. Die Darstellungen von Reisen, die Vorführungen wichtiger Tagesereignisse, fremder Länder und Menschen, wie überhaupt die Übermittelungen eines ungeheuren Lebensstoffes müssen den Horizont erweitern, den Betätigungstrieb wecken und anstacheln, durch Vorführung der verschiedenen Sitten und Gewohnheiten der eignen und anderer Nationen die Liebe zur eigenen Heimat stärken und gleich im Sinne einer Verständigung der Völker untereinander wirken. Es muss dies bis zu einem gewissen Grade zugestanden werden. Und wir begrüssen es, wenn von diesen und verwandten pädagogischen, wissenschaftlichen, hygienischen (für die Massen so wichtig!) und volkskundlichen Gesichtspunkten aus Gemeinden und pädagogische Anstalten sich der Kinos bedienen, selbst Kinounternehmer werden und damit wertvolle Aufklärungsarbeit leisten. Wir sagten aber mit Absicht "bis zu einem gewissen Grade"; denn es darf nicht verkannt werden, dass im Bilde trügerische Elemente ruhen und dass wir aus Abneigung gegen eine übertriebene, häufig die Oberflächlichkeit fördernde Sucht nach Bildern eine Wandlung des Zeitgeschmacks wünschten, die lieber auf das Vielerlei verzichtete und das Bedürfnis fühlte, ihr Wissen über ein begrenztes Gebiet gründlicher zu gestalten und über die blosse Bildhaftigkeit hinaus nach Erkenntnis und Wahrheit zu forschen.
Die andere, grössere Gefahr bilden die den Schundromanen ähnlichen Bildererzählungen, wie wir sie in den meisten Kinos vorgeführt bekommen. Nicht etwa dass diese Geschichten in ihrer Tendenz unmoralisch wären. Im Gegenteil, sie triefen von Moralität, Belohnung des Guten und Bestrafung des Bösen, Kindesliebe, Gattentreue usw. Und es gibt sogar Kultur-Kinoschwärmer, die sich von dieser sehr vereinfachten und leicht eingehenden Kinomoral einen günstigen Einfluss auf die moralischen Ansichten jener Volksschichten versprechen, die für die komplizierteren Wertungen einer höheren Ethik doch noch unzugänglich sind; also das Kino als eine Art Parallelerscheinung zur Heilsarmee, bei dieser: Hilfsbereitschaft auch dem Tiefgesunkensten gegenüber, bei jenem: moralische Rippenstösse für den ethisch noch Unempfindlichen. Auch hier wird man die Möglichkeit günstiger Beeinflussung nicht leugnen können. Aber man wird sie auch nicht überschätzen dürfen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Empfindung des Sensationellen an einer moralischen Geschichte und der Empfindung dieses Moralischen selbst, und wir glauben, dass im Kino eben nicht so sehr dieses Moralische selbst das Wirksame ist, sondern jenes Sensationelle. Denn es fehlt dasjenige Moment, welches den Vorgang erst aus der Sphäre der Sensationen heraus hebt und ihm eine bestimmte moralische Deutung gibt, nämlich das Wort; und zwar das von einem lebendigen Menschen gesprochene Wort. Wir wollen hier nicht in den entgegengesetzten Fehler verfallen, die Möglichkeit der moralischen Wirkung durch das, was von der Bühne aus gesprochen wird zu überschätzen. Aber gerade weil wir sie nicht überschätzen, sind wir überzeugt, dass die in Sensationen umgesetzte Moral der Kinos so gut wie gar keine erzieherische Wirkung ausüben wird. Hingegen hat sie verstärkt die gleiche üble Wirkung wie minderwertige Lektüre.
Für die kunsterzieherische Frage gelten auch ungefähr dieselben Bedenken wie bei der Schundliteratur. Wie dort das Schundbuch in ideelle Konkurrenz mit dem wertvollen Buch tritt, indem es unter derselben Flagge statt künstlerischer Werte das Surrogat rein stofflicher Sensationen gibt, so wird im Kino unter der Flagge "Theater" statt Kunst photographischer Abklatsch des Lebens geboten. Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass alle Versuche, das Kino künstlerisch zu heben, zwar von guten Absichten ausgehen, aber eigentlich im Effekt das Gegenteil von dem erreichen, was sie bezwecken. Denn jede Grenzverwischung erhöht die Gefahr, Surrogote für echte Ware zu halten. Das künstlerisch vervollkommnete Kino kann im besten Fall eine der Pantomime ähnliche, vom verfeinerten Kunstgeschmack zu würdigende Kunstform sein. Sie verlangt, wenn sie nicht plumpe Wortweglassung, sondern originale Schöpfung ist, einen hohen Grad von künstlerischer Abstraktionsfähigkeit und fast raffinierter Phantasie. Es ist einfach unsinnig zu glauben, mit solchen für ästhetische Gourmands zugeschnittenen Rezepten sei das Kino künstlerisch zu retten. Was die breiten Massen am Kino erfreut und reizt, ist grade die Weglassung jeder Art von künstlerischer Formung, ist die direkte Übermittelung wirklichen oder zurechtgemachten Lebensstoffes, ohne jede seelische Belebung durch das Wort oder durch die künstlerische Gestaltung. Je deutlicher man sich die Unmöglichkeit macht, aus Kino Kunst zu machen, und zwar vollsinnliche, plastische und seelischbelebte Kunst, um so klarer wird, dass für die Erziehung zur Kunst das Kino nicht im geringsten etwas leisten kann, dass es aber durch die Gewöhnung, im Vorgang, im rein Stofflichen allein sich "künstlerisch auszuleben", den Weg zur eigentlichen Kunst versperrt. Wir fassen zusammen: das Kino ist eine neue Art der Volksunterhaltung neben andern älteren, und innerhalb dieser Sphäre ebenso berechtigt oder unberechtigt wie alle Volksunterhaltung. Es kann auch in beschränktem Masse der Pädagogik des Wissens dienen. Mit Kunst hat es nichts zu tun. An der künstlerischen und sittlichen Erziehung des Volkes kann es daher nicht so sehr mitarbeiten. Seine Gefahr beruht aber darin, dass es einmal durch gewisse formale Ähnlichkeiten mit Kunstdarbietungen in einer für die gegenwärtigen Theater verhängnisvollen direkten Konkurrent den Bühnen einen, wenn auch wohl nicht allzu grossen Zuschauerkreis entzieht, dann aber auch, dass es durch eine viel gefährlichere indirekte Konkurrenz die im Volke schlummernden künstlerischen und moralischen Tendenzen nicht heranbildet, vielmehr verbildet und in falsche Bahnen leitet.
Reflektieren wir über die Mittel, mit denen erfolgreich dieser Gefahr entgegengetreten werden kann, so möchten wir vorausschicken, dass wir von polizeilichen Massregeln gegenüber Zeitströmungen im Allgemeinen wenig halten. Durch Massnahmen der Polizei und Obrigkeit, sei es Kommune oder Staat, können nur Auswüchse beseitigt werden. Soweit das beabsichtigt ist, wie z. B. in der Beschränkung des Kinobesuchs von Kindern, in der strengen Durchführung der Bestimmungen betreffs Feuersicherheit, in dem Verbot der Vorführung direkt unsittlicher Films, so ist das gutzuheissen. Allerdings müssen wir auch hier eine Einschränkung machen und zwar beim Begriff des unsittlichen Films. Der Einspruch der Polizei darf hier nur bis zur Inhibierung der allergröbsten Verstösse gehen, d. h. sie darf nur die Prinzipien anwenden, wie sie für alle Variétés und Vergnügungslokale in Betracht kommen. Ein Kino mit Zensur wie beim Theater erscheint schon deshalb nicht zweckmässig, weil dadurch dem Kino ein Platz angewiesen und damit eine Ehre angetan wird, die es nicht verdient. Zu billigen ist die Unterwerfung des Kinos unter den § 33a der Gewerbeordnung; gerade von dem Gesichtspunkt aus, dass es kein Bildungs- [Bildungslokal], sondern Vergnügungslokal ist, und darum den gleichen Bedingungen unterworfen werden sollte wie diese. Damit wird aber auch schon die Zahl der direkten Massnahmen erschöpft sein. Alles andere liegt auf dem Gebiete der Volksaufklärung und der Besserung der bestehenden Einrichtungen. So sollte das Theater durch technisches Entgegenkommen auf der einen Seite, d. h. durch billige Plätze, späte Anfangszeit, kurze Stücke, abwechselungsreiches Programm, bequeme Sitzgelegenheiten auch bei den billigen Plätzen, bei neuen Theatern vielleicht Bevorzugung des amphitheatralischen Baues usw., das Kino bekämpfen, und auf der anderen Seite durch strenges Betonen des Kunstcharakters. Wir verkennen nicht, dass damit die wirtschaftlichen Grundlagen des Theaters sich ändern müssen, dass mit der Durchführung dieses Prinzips dem Staat und den Städten wie allen volksbildnerischen Bestrebungen die Pflicht auferlegt wird, durch entsprechende Zuschüsse den Theatern die Möglichkeit zu geben, Kunstinstitut zu sein, und sie wie andere Bildungsinstitute, wie Universitäten, Museen, Schulen, als zu ihrem Pflichtenkreis gehörig zu betrachten. Die Entwickelung drängt auf solche Überlegungen hin. Und es ist vielleicht eine Zeit nicht mehr fern, wo sich eine Stadt ebenso weigern wird, in ihren Theatern alberne Possen aufzuführen, als sie jetzt nicht gestatten würde, in ihren Museen Illustrationen aus der "Woche" oder beliebte Genre-Ansichtskarten auszuhängen. Und wenn wir einmal das Theater für die Kunst, nicht nur das Theater "zum Vergnügen der Einwohner" haben werden, dann werden vielleicht auch wieder die universalen Dichter kommen, die auf grosse Massen wirken können, ohne für den Beifall ihren künstlerischen Wert zu opfern; denn die Universalität des grossen Kunstwerks besteht nicht darin, dass es jedem den eigentlich-künstlerischen Wert sofort enthüllt, sondern dass es jedem etwas zu geben weiss. Es kann nie entgegengehalten werden, dass die Empfänglichkeit des Durchschnittspublikums z. B. bei einem Stück wie "Götz von Berlichingen" oder "Faust" auch nur den stofflichen Reiz zu geniessen imstande ist. Selbst wenn dies der Fall ist, so tritt bei dem Anhören des echten Kunstwerks hierzu die Empfindung (wenn zunächst auch nur als Ahnung) einer Formung und inneren Belebung des rein Stofflichen durch die Persönlichkeit des Dichters. Und diese dunkle Empfindung von etwas, das in seiner Wirkung mehr ist als der blosse Reiz des Stofflichen, wird auch einem niederen Geschmack aufgezwungen, sodass er fast gegen seinen Willen zu einem höheren Geschmacksniveau heran- [herangezogen] und heraufgezogen wird. Es ist gänzlich unsinnig zu sagen: weil die grosse Masse des Volkes doch nur das Stoffliche zu goutieren in der Lage ist, ist es gleichgültig, was man ihm bietet. Nein, gerade weil es selten in der Lage ist, Wert und Unwert zu unterscheiden, ist die Gesellschaft, sind die von ihr eingesetzten Übermittler geistiger Werte verpflichtet, das beste gerade gut genug sein zu lassen.
Man bekämpft also nach unserer Ansicht das Kino am besten dadurch, dass man seine wertvollen belehrenden Tendenzen unterstützt, dass man ihm den Platz, der ihm als einem Unterhaltungsfaktor unserer Tage gebührt, zuweist, dass man ähnlich wie bei der Schundliteratur das Volk über seinen wahren Charakter, der mit Kunst nichts zu tun hat, aufklärt, und dass man die wahre Pflegestätte der Kunst, das Theater reformiert.
=============
Vom Werte und Unwerte des Kinos.
Vorbemerkung: Wie unseren Lesern erinnerlich sein wird, erschien im I. Morgenblatt vom 10. Mai unter dem Titel "Vom Werte und Unwerte des Kino" an dieser Stelle ein redaktioneller Artikel. Wir fassten unsere Meinung über das Kino dahin zusammen, dass es eine neue Art der Volksunterhaltung neben andern älteren sei und innerhalb dieser Sphäre ebenso berechtigt oder unberechtigt wie alle Volksunterhaltung. Es könne auch in beschränktem Masse der Pädagogik des Wissens dienen. Mit Kunst habe es nichts zu tun. An der künstlerischen und sittlichen Erziehung des Volkes könne es daher nicht mitarbeiten. Seine Gefahr beruhe aber darin, dass es einmal durch gewisse formale Ähnlichkeiten mit Kunstdarbietungen in einer für die gegenwärtigen Theater verhängnisvollen direkten Konkurrenz den Bühnen einen, wenn auch wohl nicht allzu grossen Zuschauerkreis entziehe, dann aber auch, dass es durch eine viel gefährlichere indirekte Konkurrenz die im Volke schlummernden künstlerischen und moralischen Tendenzen nicht heranbilde, vielmehr verbilde und in falsche Bahnen leite. In Bezug aus die Mittel, mit denen erfolgreich den schädlichen Tendenzen entgegengetreten werden könne, bemerkten wir, dass wir von polizeilichen Massregeln gegenüber Zeitströmungen wenig hielten und sie daher nur in besonders krassen Fällen angewendet sehen wollten. Im übrigen bekämpfe man nach unserer Ansicht das Kino am besten dadurch, dass man seine wertvollen belehrenden Tendenzen unterstütze, dass man ihm den Platz, der ihm als einem Unterhaltungsfaktor unserer Tage gebührt, zuweise, dass man ähnlich wie bei der Schundliteratur das Volk über seinen wahren Charakter, der mit Kunst nichts zu tun hat, aufkläre, und dass man die wahre Pflegestätte der Kunst, das Theater reformiere. Wir sandten diesen Artikel einer Anzahl von Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben stehen, mit der Bitte, unter Bezugnahme auf unsern Aufsatz zur Kinofrage Stellung zu nehmen. Eine Reihe der uns zugegangenen Antworten geben wir in nachfolgendem wieder: [Vor den Namen nur hier: >>]
[>>] Professor Dr. Oskar Bic:
Ich glaube zunächst nicht, dass irgend eine Massnahme, eine Theorie oder irgend ein Artikel die Kino-Bewegung aufhalten wird. Sie kommt offenbar dem dummen Bedürfnis Bilder lieber zu sehen, als Stücke zu hören, und zwar bequem und unverantwortlich zu sehen, so entgegen, dass sie einen Volksinstinkt trifft. Gegen Volksinstinkte kämpfen Götter und Ästheten und Moralisten vergebens. Man müsste die Anklage zurückschrauben bis zur Erfindung der Photographie. Seitdem es schnell hergestellte Illustrationen gibt, ist der Genuss an eilig durchgeblätterten Bilderjournalen ständig gewachsen. Man hätte sagen können, die Photographie untergräbt die Malerei, oder die illustrierten Zeitschriften das Lesen guter Artikel, wie man sagt, das Kino schadet dem Theater. Natürlich hat das alles geschadet, aber nur wirtschaftlich, nicht ernstlich, geistig, moralisch. Und nur dafür können wir einstehen. Wenn einige Ölporträtisten ihr Handwerk verloren durch die Erfindung Daguerres oder einige schlechte Bücher liegen blieben, weil man auf die "Woche" abonniert ist, oder ein paar mässige Theater vor den Kinos krachen mussten, so schadet das nichts. Vielleicht ist die Lust zum Ölporträt, zum Bücherkaufen, zum Theater in einzelnen Fällen sogar geweckt worden durch diese dunklen Unterschichten, dort, wo sie sonst garnicht entstanden wäre. Schliesslich hat man weder von einer Verschlechterung der Malerei noch der Literatur noch des Theaters gehört. Eine Bewegung hat ihre Gründe oder hat sie nicht, dann besteht sie oder vergeht. Die Lust am mechanischen Bilde ist dauernd gestiegen, sie hat im Kino ihre Phantasiehöhe erreicht. Das mag benachbarten Gebieten etwas Geld abgraben, die Bilanz bleibt schon. Vielleicht verdienen Schauspieler am Kino ein Honorar, das sie vergeblich auf einer Schmierenbühne suchen. Das Grammophon kann auch schrecklich sein, doch ist es nützlich und oft sehr gut. Die Lust am mechanischen Gehör ist ebenso gewachsen. Der Oper hat es im Grunde nicht geschadet, vielleicht genützt, und den Sängern erst recht. Von der Wissenschaft garnicht zu reden, die sowohl im Falle der akustischen als optischen Mechanik über diese Erfindung glücklich ist.
Nachdem dies festgestellt ist, handelt es sich nur um die Beurteilung der Kinoleistungen selbst, die wie alle anderen Dinge in der Welt, und namentlich die neuen, kindisch populär und hochfein sein können. Ich habe immer einen grossen Reiz davon gehabt und wurde vor den rutschenden Tunnels, galoppierenden Indianern und brausenden Meereswogen wie zum Kind. Es gefiel mir besser als manche Operette des neuen Wien. Sonst verglich ich es ja nicht mit dem Theater, wie ich eine Photographie nicht mit einem Bilde von Monet, oder die illustrierte Zeitung mit Selma Lagerlöfs "Jerusalem" vergleiche. Über anderes ärgerte ich mich, Erschiessungsszenen und Mordgeschichten, doch ärgerte ich mich über Tosca noch mehr. Vieles war so phantastisch, mit einer so klugen Benützung der eigentümlichen Kinotechnik, dass ich anfing, selber solche mechanischen Vexierkomödien zu erfinden, z. B. wie ein Theaterdirektor auf eine Kirchturmspitze klettert, von einer Wolke einer Dame auf den Hut geworfen wird und dort als Ornament weiter figuriert. Kurz: es gibt viel Scheussliches, aber auch viel Schönes. Wie das so ist. Es bindet manche Phantasie ab, aber reizt sie auch wieder, es verschlechtert oft das Theater, aber übertrifft es auch oft. Jeder nimmt sich daraus, was er braucht. Eingriffe sind gefährlich, künstliche Veredelungen eine Ideologie. Wir sind so klug und erzieherisch, dass wir täglich in der Gefahr sind, ein Kind mit einem Bade auszuschütten. Ich liebe die Mannigfaltigkeit, die Dummheit und die Natur.
[>>] Dr. Frederik van Eeden:
Ihrer Meinung über das Kino kann ich im grossen ganzen nur beipflichten. Es ist aber eine Kulturerscheinung, die nicht mit kleinen Mitteln zu bekämpfen ist, sondern deren Verlauf durch die Massenänderung des ganzen Volkes bedingt werden wird. Es enthält auch neue Werte und hat einen ihm eigentümlichen Reiz, auch für Hochgebildete, und ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass es ohne weitere Entwicklung verschwinden oder dass es bloss Vergnügungsmittel bleiben wird. Ich glaube daher nicht, dass das Kino nie etwas mit Kunst zu tun haben werde. Ich sehe die Möglichkeit, aus dem Kino - verbunden mit Musik - etwas sehr Schönes zu machen. Und warum soll das Wort dabei immer ausgeschlossen bleiben? Denken wir uns z. B., dass kinematographische und phonographische Aufnahmen schon zur Zeit des Augustus möglich gewesen wären, und wir könnten heute eine Rede des Cicero sehen und hören - wäre das bloss als Unterhaltung oder für Archäologen interessant? Auch könnten Bilder aus dem Tierleben oder vom Blumenwachstum so vorgeführt werden, dass sich eine wirkliche Schönheit ergibt, die durch geeignete musikalische Begleitung sich steigern liesse zu etwas, das vielleicht mit dramatischer Kunst nicht auf einer Höhe stände, aber dennoch zu den reinsten Genüssen eines kunstsinnigen Menschen zu zählen wäre. Das hängt alles davon ab, dass durch den Genius die mechanische Leistung von innen belebt wird. Es ist ein Irrtum, anzunehmen, dass die Ausbildung der Technik die Kunst immer herunterziehen muss. Ein verbessertes Werkzeug ist auch dem echten Künstler willkommen, und ich bin gewiss, dass z. B. Lionardo das Kino mit Begeisterung begrüsst haben würde und es vielleicht zu wunderbaren Leistungen verwandt hätte. Und die Menge wartet nur auf eine kraftvolle Anregung und Führung, um zwischen Schund-Kino und schönem Kino zu unterscheiden. Die Menge füllt zwar die Variétés und Tingeltangels - aber als in Amsterdam der Oratorien-Verein die schönen, reinen Werke von Haydn und Mozart der Menge zugänglich machte, da waren die Konzertsäle mit 3000 Plätzen zwei oder drei Abende hintereinander überfüllt. Der gute Geschmack ist nicht Monopol der Elite, nur soll man den kindlichen, ungebildeten Geist führen und belehren.
[>>] Friedrich Freksa:
Der Kinematograph in seiner bisherigen Entwicklung und Einwirkung auf die grössere Menge gehört zu den exemplarischen Beweisstücken für die Behauptung, dass die Zeit ihre technischen Errungenschaften weder richtig begriffen noch richtig angewandt hat. Die technische Entwicklung ist mit der Schnelligkeit eines Bambus emporgeschossen und überragt all die anderen langsam reisenden älteren kulturellen Gewächse. Die Phantasie des Dichters fährt noch in der Postkutsche, während die Phantasie des Technikers schon im Aeroplane daherbraust. Darum soll die wundervolle Erfindung des Kino nicht verdammt werden, sondern die Zeit soll danach streben, sie zu verdauen.
Selten wohl hat eine Zeit so sehr am Augenhunger gelitten wie die unsere. Denn Telegraph, Zeitungen, Verbindungswege haben die ganze Welt enge zusammengerückt. Von allen Seiten drängen auf den an seinen Sitz gebundenen, arbeitenden Menschen fremdartige Vorstellungen ein, mit denen er keine plastischen Gesichtsvorstellungen verbindet. Dies spiegelt unsere bildarme, abstrakte Sprache wider, die Gemeingut der bürgerlichen Menschen geworden ist an Stelle der bildhaften, mit Gesichtsvorstellungen gesättigten Sprache unserer Grossväter, bei denen noch nicht die Incohaerenz zwischen Vorstellung und Auge obwaltete wie bei uns.
Darum leiden wir am Augenhunger, und diesen wenigstens materiell zu befriedigen ist nichts so geeignet, wie der Kinematograph. Er ist für unsere Tage ebenso wichtig wie seiner Zeit die Kartoffel, die die Ernährung der schnell anschwellenden Menschenmassen ermöglichte.
Allein, während der Wert der Kartoffel von den Regierungen sofort erfasst wurde (denn für Magenfragen ist stets ein ursprüngliches Verständnis da, das der Gutsbesitzer und Administrator schon im Viehstalle sich aneignet) gingen bisher die praktisch wirkenden Staatsmänner an den ebenso wichtigen geistigen Volksbedürfnissen, die nicht sofort ihre Zinsen für den Bürger- [Bürgerdienst] und Militärdienst tragen, glatt vorbei.
Der Kinematograph in Verbindung mit dem Grammophon wäre geeignet, grosse und fruchtbare Volksakademien ins Leben zu rufen, wenn sich Städte, Universitäten, Zeitungen und Künstler auf die Pflichten besännen, die sie gegenüber den Millionen ihrer Volksgenossen haben. Im Volke schlummert die heisseste Begierde, die grossen Ereignisse des Tages mitzuerleben. Sensationsgier wird nur dadurch gezüchtet, wenn das Volk von dem vorschreitenden geistigen Leben der Nation ausgeschlossen wird.
Es sind Sensationsgier und geistige Begierde zwei Früchte aus derselben Blütendolde. Die alten Sagen, die alten Mären wandten sich in glücklicher Mischung an diesen zwiegespaltenen Trieb gleichzeitig. Schauergeschichten, Bänkelgesänge lösten die alten, grossen Epen ab. Am Ende wurde die kleine, leicht fassliche Zeitung daraus, bis mit dem Steigen der Halbbildung der Wertschätzung der Mittelschulen, dem Wachsen der Bildungspfisterei jener heutige unerträgliche Zustand geschaffen wurde, dass wir drei Volksschichten haben: erlesene Fachgenies, Mittelschulbildungsprotzen und die ungeheure fruchtbare, unverdorbene Masse des Volkes.
Die Menschen, die acht bis zehn Stunden des Tages mechanisch arbeiten, deren Hirn am Werktische, am Schreibpulte, im Strassenstaube austrocknet, die finden ihre Erholung, ihr Augenfutter, ihr plastisches Vorstellungsmaterial im Kino. Greulich verzerrt ist es oft, sentimental, übertrieben wie alles, was in die Fäuste von Geschäftsmenschen geraten ist, die nur Geschäfte machen wollen. Und doch, der Kinematograph hat die Mission, das Volk das geistige Leben und Ringen der Zeit mitfühlen zu lassen. Er kann der moderne Ausdruck der Saga werden. Es heisst nur den Mut haben, alte Dinge in neue Werte umzudenken.
Aber es ist nötig, dass dieses wertvolle Instrument nicht in die Hände von Unberufenen kommt. So wie wir uns gegen den Brotwucher wehren, so sollen wir uns auch gegen den Wucher mit dem Augenfutter für unser Volk wehren. Heran, Städte, Zeitungsunternehmer, Universitäten, Künstler, Dichter, schafft dem Volke das, was es braucht.
Dass zwanzig, dreissig Theater dabei zum Teufel gegangen sind, freut mich nur, denn was diese Institute, die nicht einmal den Geist, den herrlichen Geist unserer alten Schmieren besitzen, bedeuten, weiss ich aus Erfahrung. Es sollen noch mehr Theater zu Grunde gehen! Denn das Theater im alten Sinne hat sich ja überlebt! Gesteht es doch ein! Alle, die ihr im Theaterleben tätig seid, wisst, dass das alte Theater dem Tode verfallen ist.
Wir brauchen: Sehr wenige kleine Schauspielhäuser mit sehr hohen Preisen, wo sich alle geistigen Exzentrizitäten austoben können, ein zensurfreies Theater für die Gourmets. Wir brauchen grosse schöne Volksfestspielhäuser, in denen für billiges Geld dem Volke grosse Kunst geboten wird. Hier ist die Aufgabe, wo sich Künstler mit den Gewerkschaften zusammentun müssten, die freien Volksbühnen bedeuten den Anlauf dazu. Mehr und mehr werden sie die jetzt üblichen Theatergeschäfte zerschmettern.
Und drittens wird alle die kleinen Schmieren, alle die bösen hässlichen Kunstinstitute der Kino vernichten - dem Himmel sei Preis und Dank. Es wird möglich werden, in Verbindung mit dem Grammophon dem Volke den Abglanz guter Kunstwerke zu vermitteln, es wird möglich sein, die Zeit widerzuspiegeln, wie es der Dichter ja kaum mehr kann. Und es wird gut sein, dem Volke nicht etwa pädagogisch zu kommen, denn dazu ist es zu gesund, dann bleibt es fort. Künstler, die naive Freude an der Buntheit des Daseins haben, sind berufen dazu. Und darum, lasst den Kinematographen nicht in die Hände des Staates fallen, gründet Privatgesellschaften, zieht die Städte heran, und vor allem begreife die Presse, dass zu ihren Pflichten richtige Verwendung des Kinematographen gehört. Grosse Zeitungen sollten sich zusammentun, sollten ihre Films austauschen, sollten ihren Lesern plastische Bilder vermitteln.
So könnte das grosse Zeitalter der Presse kommen.
Aber vergesst nicht, die Zeit ruft! Der Staat wird seine Hand auf dies wundervolle, mächtige Propagationsmittel für Ideen und Anschauungen legen. Gierige Unternehmertrusts sind im Bilden begriffen. In fünf Jahren kann es zu spät sein, und die Zeit hat ihre Saga verloren.
[>>] Ernst Heilborn:
Unter den zahllosen Films, die ich gesehen, hat sich einer meinem Gedächtnis eingeprägt. Ein Umzug von einer Wohnung in die andere wurde dargestellt, doch so, dass nirgends eine menschliche Hand zugriff. Der pferdelose Möbelwagen rollte vor das Haus, die Türen des Gefährts sprangen auf, die schweren Stücke der Zimmereinrichtung glitten selbsttätig, doch behutsam auf die Strasse. Sie rutschten die Treppe empor. Sie glitten durch die Zimmer, bis sie ihren Platz gefunden hatten. Vor die Schränke stellten sich die gefüllten Körbe. Der Deckel klappte auf. Nun flogen die Wäschestücke, Porzellan und Gläser automatisch an ihren Platz. Es war da ein offenbar noch sehr junger, unerfahrener Tisch. Er irrte hilflos durch die Zimmer. Er kam schliesslich bettelnd zu einem Schrank, der denn auch ein Einsehen hatte und ihm eine Decke herausgab. Der Tisch wanderte aber ruhelos weiter, bis sich eine Lampe entschloss, auf ihm Platz zu nehmen. Nun schien er befriedet und stellte sich gehorsam neben das Bett.
Es waren ganz eigene, romantisch-ironische Eindrücke, die der Anblick dieses Films vermittelte; wertvoll für die, die ihnen kritisch nachsannen; wertvoller natürlich für die andern, die das alles naiv auf sich einwirken lassen. Aber nicht das ist der Grund, warum ich davon spreche. Sondern: dieser Film scheint mir wegweisend für die Kinematographie. Sie wird aufhören, Dramen zu spielen. Sie wird sich auf die Wirkungen besinnen und sie entwickeln, die ihrer Technik als solcher gegeben sind.
Darum, weil wir eben erst in den Anfängen der Kinematographie stehen, scheint mir ein Vergleich zwischen Bühne und Kino unzutreffend. Es heisst das, ein Kind in Parallele zu einem Mann in den "Besten" Jahren stellen. Der Vergleich scheint mir aber auch unzulässig, denn die Bühne will Kunst, der Kinematograph will Technik vermitteln. Mit der Moralfrage aber hat weder die Kunst als solche, noch die Technik als solche das Geringste zu schaffen. Was wir "moralische Wirkung" nennen, ist die Süsse der Lebenserkenntnis; ist aber auch der Zucker, den wir mit täppischen Händen auf die Speisen der Wirklichkeit streuen. Natursüsse kann nur die Kunst bieten; gewiss; die Technik der Kinematographie aber hat nur deshalb so vielfach ihre Darstellungsobjekte überzuckert, weil sie sich in einen Wettstreit mit der Kunst einliess, der ihrem Wesen fremd ist. Oder, weil Polizeimassregeln ihr das anempfahlen.
Der Vergleich zwischen Bühne und Kino ist unzulässig, er war ja aber auch nur deshalb gezogen, um auf die "gefährliche" Konkurrenz zu deuten, die zwischen beiden besteht.
Jahre sind darüber vergangen: ich kam zu einem älteren Freund, mit dem ich eine Zeitschrift redigierte, um ihm mit besorgter Miene mitzuteilen, dass ein Konkurrenzunternehmen entstanden sei. Er hörte mich lächelnd an und sagte lächelnd: "Was ist da zu fürchten? Freuen wir uns lieber! Es ist sehr viel leichter, einen Menschen, der eine Zeitschrift hält, dazu zu bringen, sich eine zweite anzuschaffen, als den, der gar keine liest, zum Abonnenten zu gewinnen.
Etwas Ähnliches scheint mir auf die Konkurrenzfrage zwischen Kino und Bühne zuzutreffen. Gewiss, es werden viele das Lichtspieltheater statt des wirklichen Theaters aufsuchen; es werden aber auch ungemein viele vor dem toten Film die Sehnsucht nach der lebendigen Darstellung der Bühne verspüren und ihr nachgehen.
Und denken wir dieser Konkurrenzfrage einen Augenblick logisch nach! Wir hören, dass im letzten Jahr 22 Theater in Deutschland dem Kino unterlagen und ihre Pforten schliessen mussten. Es gingen doch aber in diesem Kampf die schwächsten, also die schlechtesten Theater zu Grunde? Die lebenstüchtigsten, also die besten, blieben bestehen? Ja aber, wenn die besten Theater von der Konkurrenz der schlechteren Theater befreit werden (wir nehmen mit dem Verfasser jenes Aufsatzes einen Augenblick lang an, Konkurrenz sei ein Übel) so bedeutet das ja einen Gewinn für die besten Theater und damit für die Kunst?
Auch hat man das alles schon einmal durchgemacht. Das war, als die Daguerreotypie auskam und die Portraitmaler sich an die Brust schlugen: nun würde sich niemand mehr malen lassen! Ich glaube nicht, dass sich heut weniger Leute Porträts bestellen als vor 70 Jahren; ich glaube nicht, dass die Photographie uns um einen Rembrandt betrogen hätte; aber ich weiss, dass die photographische Technik ungemein viel Malern ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden ist.
Es war vorangeschickt worden, dass ich die Aufführung von Dramen für einen Irrweg der Kinematographie erachte. Aber gerade für uns, die wir der Bühne ein immerwährendes Studium widmen, sind diese Dramenaufführungen von höchstem Wert. Der kinematographische Darsteller ist nur auf sein Mienen- [Mienenspiel] und Gestenspiel angewiesen, jede Wirkung muss er hieraus zu schöpfen trachten: das hat zunächst zu grotesken und brutalen Übertreibungen geführt; man sieht aber heute schon, namentlich auf französischen Films, Leistungen, die ganz dezent, ganz keusch sind, und dabei starke Ausdrucksfähigkeit ausweisen. Hier wird von dem Darsteller höchste Selbstzucht erfordert; hier wird dem Zuschauer ein Material geboten, an dem er unablässig lernen kann. Zumal der schnelle Wechsel der Films in rascher Folge französische, deutsche, englische, italienische Darsteller ruft. Das Kinotheater ist bereits eine Art Bühnenschule.
Es hängt wohl mit der Nervosität unserer Zeit zusammen, dass die Furcht vor der Konkurrenz ein bestimmender Faktor in unserem gesamten Wirtschaftsleben geworden ist. Ob das ein Ruhmestitel unserer Zeit, lasse ich dahingestellt. Nie aber wird man eine Konkurrenz - also auch die zischen Kino und Bühne - ganz unterbinden können oder dürfen. Wohl aber könnte man Massregeln ergreifen, die Bühne in ihrem Existenzkampf gegen den Kino zu stärken. Dient das den Bühnen, soweit sie ernste Kunststätten sind: gut. Für notwendig erachte ich es nicht.
[>>] Helene Lange.
Bei einer Diskussion über Wert und Unwert des Kino wird man unterscheiden müssen zwischen dem Kino als technischem Reproduktionsapparat und dem Kino als Schauspielfabrikant. Alle Vorzüge beruhen auf der ersten, alle Verderblichkeiten auf der zweiten Eigenschaft. Denn an sich, als technische Erfindung, könnte man den Kinematographen der Buchdruckerkunst an die Seite stellen, die dem Auge alle fremden Welten erschliesst. Und ist es nicht schön, dass das abstrakte Wort nun von der Anschauung ergänzt und zum Teil abgelöst werden kann? Soll man nicht die Hoffnung daran knüpfen, dass wir von Buchstabenmenschen wieder mehr Augenmenschen werden? Man könnte allen Fluch des Kino in Segen verwandeln, wenn es möglich wäre, ihm das Dichten zu verbieten und es strikt auf die Reproduktion des tatsächlichen Lebens einzuschränken. Das wäre die einzige Zensur, die wirklich etwas nützen könnte: das Kino darf keine selbsterfundenen Nummern aufführen, es darf nicht dichten.
Dass durch andere Polizeiverbote die Auswüchse getroffen werden, bedeutet gegenüber der eigentlichen Gefahr sehr wenig - umso weniger, als alle solche Verbote erfahrungsgemäss als Reizmittel wirken. Man beschränke den Kino-Besuch der Kinder - sicher wird dadurch das Kino an geheimnisvollem Reiz für den Heranwachsenden gewinnen. Man verbiete die "unsittlichen" Films - sicher wird die Kunst, das Obszöne mit ausreichender Unmissverständlichkeit anzudeuten, erst recht provoziert und die Phantasie der Zuhörer erst recht ins Reich der unanständigen Vermutung gelockt werden. Mit diesem Hinweis auf die Nebenwirkung solcher Polizeibeschränkungen soll ihnen nicht die Notwendigkeit abgesprochen werden. Es wird nicht anders gehen. Aber viel positive Wirkung soll man nicht davon erwarten. Und da an eine Zensur wie die empfohlene bei uns nicht zu denken ist, muss damit gerechnet werden, dass die Kino-Seuche noch erheblich in die Breite geht.
Ob die Konkurrenz, die den Theatern gemacht wird, die bedenklichste Seite der Sache ist, lasse ich dahingestellt. Wir haben zugestandenermassen viel zu viele Theater, die sich - schon vor der Kinogefahr - nur halten konnten, indem sie wirtschaftlich und künstlerisch gleich bedenkliche Konzessionen machten. Die "Schlager" der kleinen Bühnen liegen nicht so sehr weit oberhalb des Kientopp-Niveaus. Die Schauspielernot, die in dem Bestehen einer Unzahl nicht genügend fundierter Theater ihre eigentliche Quelle hat, nötigt einem sogar direkt die Frage auf, ob nicht das Kino als ein weniger kostspieliger Apparat das sozial harmlosere Mittel ist, die Schaulust der Kreise zu befriedigen, auf die kleine Theater rechnen müssen. Wenn also durch das Kino eine gewisse unterste Schicht von Theatern verdrängt wird, wäre das rein wirtschaftlich und sozial betrachtet, nicht so sehr zu beanstanden.
Künstlerisch freilich heisst es den Teufel mit Beelzebub austreiben, darüber kann kein Zweifel sein. Ausser den Momenten, in denen die "Frankfurter Zeitung" den Unwert des Kino sieht, möchte ich noch zwei nennen: die Massenhaftigkeit des Stoffs - und die geradezu abstossende Gewöhnlichkeit der Darsteller, die als Originale für die Films gedient haben. Das letzte ist ästhetisch oft schlimmer als der Inhalt der Stücke. Die technisch erforderliche Übertreibung der Ausdrucksbewegungen steigert die vulgäre Plattheit der ursprünglichen Auffassung zu einem Grade, in dem sie vielleicht verrohender wirkt als der Stoff an sich. Man kann an den Zuschauern diese Wirkung beobachten. Die meisten kommen nicht mit einem im voraus sicheren Geschmack, der ihnen ermöglicht, das ordinäre Sichgeben der agierenden Personen richtig einzuschätzen. Ihrem ganz labilen Urteilsvermögen wird das Gesehene Massstab: die schauderhafte Süsslichkeit, die gemachte Naivität, das ekelerregende Pathos. - Und dann die Überfütterung. In anderthalb Stunden zehn ein- [einaktige] oder mehraktige Stücke, sentimentale, possenhafte, sensationelle durcheinander. Vom harmlos trivialen Unsinn bis zum grauenhaft aufgebauschten Sittenstück. Natürlich kommt dem Kinobesucher hernach das Theater vor wie dem Weltreisenden eine Landpartie.
Aber zu tun ist da nicht viel. Auf einer kürzlich in Wien veranstalteten Konferenz in der über die Kinogefahr beraten werden sollte, haben die zugezogenen Kinobesitzer einfach gelacht, wenn ihnen etwa eine Änderung der Stoffe angeraten und zugemutet wurde. Das Publikum verlangt vom Kientopp nicht nur Wissen, sondern eben den Schundroman in lebenden Bildern. Volksfreunde sollen in möglichst vielen guten Kinos einen orbis pictus für alle Wissbegierigen aufmachen - aber nicht glauben, damit zugleich den Hunger nach phantastischen Begebenheiten im Stil der "Konventionsehe aus der vornehmen Welt" oder dergl. zu stillen.
Nur damit kann man vielleicht rechnen; dass sich die Sache abnutzt. Das liegt etwas in ihrer Natur. Sicher werden viele von denen, die sich mit den "Schlagern" vollstopfen, einmal blasiert werden, zumal bei aller Unermesslichkeit der Filmzahl die Motive ziemlich einförmig sind. Diese Art der Überwindung der Kinokrankheit wird ja subjektiv einer Heilung nicht gleichzusetzen sein, aber doch eine Einschränkung des Unternehmergeistes auf dem Gebiet herbeiführen.
Ausser dieser Hoffnung bleiben natürlich alle die Mittel, die nicht der direkten Bekämpfung des Kino dienen, sondern dafür sorgen, dass die Befriedigung der künstlerischen Bedürfnisse des Volkes nicht an der Kostspieligkeit guten Kunstgenusses scheitert.
[>>] Maurice Maeterling.
Ich habe zur Kinematographenfrage nicht viel zu sagen, da ich mich bis jetzt kaum damit beschäftigt habe. Meiner Ansicht nach wird die Zeit diese Leidenschaft - wie schon so viele andere - schon in die richtigen Bahnen lenken, sodass in einigen Jahren der Kinematograph nur noch ein nebensächliches Möbel im täglichen Leben sein wird, ebenso harmlos wie eine Wanduhr, ein Phonograph oder ein Kandelaber.
=============
[>>] Dr. Alfons Paquet.
Einige Punkte des redaktionellen Aufsatzes, mit dem Sie den Wert und Unwert des Kinos einer grundsätzlichen Betrachtung unterziehen, haben mich so stark interessiert, dass ich mir vornahm, bei nächster Gelegenheit nachzuprüfen, ob ich auch nach dem Besuch eines der neuesten und elegantesten hauptstädtischen Lichtspieltheaters Ihren Ansichten noch in dem Masse beistimmen könne, wie das beim Lesen des Aufsatzes der Fall war. Was wünschte ich mir, als dass Sie mit Ihrer Voraussage der indirekten heilsamen Wirkungen des Kinos auf die Entwicklung des modernen Theaterbetriebes und auf das Kommen des universalen Bühnenkunstwerkes Wort für Wort Recht behalten möchten! Von diesem Standpunkt aus habe ich das Auftauchen der grellen Licht- [Lichttheater] und Tonbildtheater mit ihrem plundermässigen Drum und Dran und ihren nickelnen Kassenerfolgen immer mit gewissen grimmen Hoffnungen betrachtet, deren Erfüllung sich im Zugrundegehn so vieler bisheriger Kunsttempel anzukündigen schien. Auf den Jahrmärkten, meinetwegen auch auf den Pariser Boulevards mögen diese Kinos am rechten Orte sein; an den langen schrecklichen Winterabenden von Werchne-Udinsk oder Charbin mögen sie auch einer Ansammlung melancholisch oder abenteuerlich gestimmter Menschen den Kontakt mit jenem fernen Paradies vermitteln, das sie sich unter der europäisch-amerikanischen Kulturwelt vorstellen. Aber zu Dutzenden an den Hauptstrassen deutscher Städte bilden sie auch dann noch eine problematische Erscheinung, wenn man durchaus kein Feind der Kinematographentechnik selber ist und von ihr sogar für das Theater der Zukunft einige Anregungen erhofft, die weit über das in Ihrem Aufsatz Angedeutete hinausgehen. Ich sehe keineswegs in einer der Pantomime ähnlichen Kunstform den möglichen Ausdruck einer künstlerischen Entwicklung des Kinos, ich halte weit eher noch seine Einstellung in die Reihe der Hilfsmittel für möglich, deren sich die dramatische Kunst gelegentlich bedienen kann.
Ich liess mich nun dieser Tage vom Zufall in eine beliebige Vorstellung führen.
Die Vorstellung zeigte u. a. folgende Darbietungen:
"Moderne Reisebilder". Man sieht, rasch vorübergleitend, die sonnige Landschaft eines norwegischen Fjords, die Ankunft eines Dampfers, das Auftreten offenbar deutscher Vergnügungsreisender an Land, beobachtet ein paar Typen der ländlichen Bevölkerung, bewegt sich dann scheinbar aus einem fahrenden Dampfer und folgt einer Wagenfahrt in die Berge zu einem Wasserfall. Anfangs folgt man diesen Darbietungen nicht ohne Vergnügen. Es stört einen aber das plötzliche Abbrechen der Bilder, das Zusammenhanglose im Wechsel der Landschaften, die Trivialität in der Wiedergabe nebensächlicher Szenen. Flecken, Risse, Sprünge in den Films hageln und blitzen vor dem Auge vorüber wie ein Bombardement von Schmutz und Funken, so dass es Augenschmerzen verursacht. Eine noch so einfache, klar erkennbare Handlung in diese landschaftliche Kulisse zu stellen, und sei es nur das moderne Idyll des in Sorglosigkeit genossenen Ferienaufenthaltes einiger Personen, müsste doch sehr reizvoll sein und dem Beschauer viel mehr geben als die jetzige, ganz unmotiviert sprunghafte, unsymmetrische, hastende Szenenfolge. Die Szenenfolge verlangt nach einer gewissen Geschlossenheit und einem, wenn auch nur losen inneren Ausbau. Das Endresultat der jetzigen Vorführung ist eine vorwiegende Missstimmung über einen empfangenen und nicht genügend befriedigten Reiz.
"Der Zauberkünstler". Offenbar ein Pariser Film aus einer der grossen Fabriken. Taschenkunststücke, von Schmierenschauspielern übelster Sorte vorgeführt. Der "Salon" und die Gesichter der dort sich unterhaltenden "Herren" und "Damen" derart apachenhaft und verkommen, dass man an die Statisten obszöner Photographien denken muss. Die vorgeführten Kunststücke haben sehr wenig Witz und haben auch nichts Überraschendes, weil man ja weiss, wie bequem das Widersinnigste für den Kinematographen arrangiert werden kann. Diese Physiognomien und das alberne, markierende Spiel dieser Statisten sind so widerwärtig, dass sie auf der kleinsten Schmierenbühne ausgepfiffen würden. Hier aber lässt sie sich ein allzu geduldiges Publikum gefallen
"Echt amerikanisch". Eine Entführungsnovelle mit einem virtuos durchgeführten Sensationsstück: der Verfolgung des Liebespaares, das sich auf einer Draisine davonmacht, durch ein Auto. Die Flüchtlinge treffen einen übers Bahngeleise reitenden Geistlichen, bewegen ihn, mit auf die Draisine zu steigen und unterwegs in voller Fahrt die Trauung vorzunehmen. Als der verfolgende Vater sie endlich nach vielen Hindernissen einholt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als dem jungen Paar seinen Segen zu geben. - Erfreulich vor allem die sympathischen, ungeschminkten und unberufsmässigen Gesichter der Darsteller; dann die frische des Einfalls und der wahrhaft groteske Humor der Durchführung, bei einem verblüffenden Naturalismus der Wettjagd. Man vergisst alle Unwahrscheinlichkeiten, man lacht herzlich! - Bescheidene Ansätze einer Exposition; im übrigen aber eine rein äusserliche Lösung des Konfliktes. Eine Handlung, die einer besseren, komödienhaften Anordnung würdig wäre.
"Der Liebe Lust und Leid". Ebenfalls ein grösseres Stück; Spielzeit fast eine halbe Stunde. Es beginnt sehr einschmeichelnd. Die beiden weiblichen Hauptpersonen - eine junge Dame und eine Matrone - sind recht anmutig. Der Golf von Neapel als landschaftlicher Hintergrund. Die kleine Liebesgeschichte des Mädchens mit einem Maler, der sich aus der Ferne in sie verliebt, ist nicht ungeschickt eingeleitet. Heimliche Verabredung zu einem ersten Zusammentreten beim Ball. Ankleidezimmer: Der Spiritusbrenner explodiert, das Mädchen geht in Flammen auf, wird durch hinzueilende Diener gerettet, aber sie hat im Gesicht schwere Brandwunden davongetragen. Grässliche breit ausgemalte Krankengeschichte. Der Liebhaber reist nach diesem Vorfall ab. Das erblindete Mädchen wird durch ihre Umgebung in dem Wahn erhalten, dass er ihr täglich Blumen schicke. Sie erlangt das Augenlicht wieder. Angst der Umgebung, dass sie nun den frommen Betrug erkenne. Da kehrt der Liebhaber zurück. Schluss: Verlobung. - Dieses Stück geht unter Unruhe im Zuschauerraum zu Ende. Auf der beleuchteten Leinwand sieht man soeben das mehr abstossende als rührende Bild der Erblindeten, geführt von Arzt und Pflegerinnen. Im Zuschauerraum ist jemand in Ohnmacht gefallen und stört die Umsitzenden durch lautes Röcheln! Man hält es erst für ein Schnarchen, glaubt, es handele sich um einen Betrunkenen. Aber der Mann kommt nicht zu sich. Es droht eine Panik. Ängstliche Frauen verlassen die Sitzreihen. Diener rennen herzu und tragen den schweren Mann zum Notausgang. Es stellt sich heraus, dass auch ein zweiter Mann einer Ohnmacht unterlag. Man öffnet ihm Kragen und Weste, die Diener bringen auch ihn beiseite. Als ich dann einen der Diener fragte, was denn eigentlich geschehen sei, erhielt ich die folgende erstaunliche Auskunft: Bei diesem Film sei das schon mehrfach vorgekommen, dass Leute es nicht mehr aushalten konnten, zum Beispiel solche, die etwas Ähnliches einmal durchgemacht haben. Die Direktion habe deshalb auch schon die krasseren Stellen gestrichen und grosse Stücke aus dem Film herausgeschnitten, fast hundert Meter. Trotzdem passiere es immer wieder. - Von dieser Feststellung hatte ich genug. Der Dilettantismus ist das Charakteristikum dieser Darbietungen. Hier aber war die Grenze, wo das unkünstlerisch sensationelle Element des Kinos die greifbare Form des grobem Unfugs erreichte. Während manche Leute den Zuschauerraum stillschweigend verliessen, ging gleichmütig die alberne Geschichte auf der Leinwand weiter, und gleichmütig spielte die unermüdliche nichtssagende Musik. Was spielten diese Musiker eigentlich? Ich traute meinen Ohren nicht. Es war das von irgend einem betriebsamen Kapellmeister in eine Zirkusmusik verarbeitete Thema aus der "Unvollendeten" von Franz Schubert.
Ich sah bald nachher, wie Leute, Frauen besonders, das elegante Kino verliessen, blass, an allen Gliedern zitternd. Da war ich nun wieder auf der Strasse. Es war mir, als hätte ich in ein Stück Chaos hineingesehen. Nach einer Fülle sich widersprechender höchst unharmonischer Eindrücke nun zum Schlusse eine wahre Depression des Gemüts! Das war mehr, als ich erwartet hatte. Aber es brachte mir auch deutlicher als jedes blosse Nachdenken zum Bewusstsein, welche Grenzlinien in der Beurteilung des Kinos gezogen werden müssen. Sicherlich wird uns einmal ein künstlerisch diszipliniertes Kino reine, schöne, ja erheiternde und bedeutende Eindrücke vermitteln können. Es kann uns ein Lehrmittel sein, aber auch ein köstliches Spiel, vielleicht sogar eine Kunst. Vielleicht wird aus ihm einmal das weltstädtische, ja auch das kleinstädtische gute, billige und bequem zu besuchende Unterhaltungstheater geboren, und es wird unser Leben, unsere Ausdrucksmöglichkeiten, unseren Humor, unsere Horizonte durch die Leichtigkeit seiner Zaubermacht erweitern, sofern sie in der Kontrolle des Geschmacks gebändigt ist. Ich kann dem Kino eine Erlösung erhoffen aus den Händen unverantwortlicher Barbarei. Aber nach dem Erlebnis dieses Abends kann ich dem Satze nicht mehr zustimmen: dass eine Zensur wie beim Theater schon deshalb nicht zweckmässig erscheine, weil dadurch dem Kino eine Ehre angetan werde, die es nicht verdient. Mit einer Zensur des Kino müsste unverzüglich der Anfang gemacht werden
Und zwar sollte man sie zu allererst dem Arzt, dem Psychiater übertragen
[>>] Walther Rathenau.
Kunst hat mit Vergnügung nichts zu tun. Kunst bereichert die Seele, Vergnügung täuscht sie über ihre Armut hinweg. Wer in der Kunst Vergnügung sucht, gleicht einem, der Dichtwerke auf Spässe oder Zweideutigkeiten hin durchstöbert. Wer sensationelle Vergnügungen mit inneren Werten, ethischen oder künstlerischen zu durchsetzen wünscht, handelt ähnlich wie einer, der Reimregeln mit historischem Inhalt erfüllen wollte.
Das mechanische Spektakel administrativ beschränken wäre ein doktrinärer und nutzloser Polizeistreich. Wen das Herz um der Kunst willen zu Hamlet und Fidelio treibt, der lässt sich nicht von der Flimmerkiste abfangen. Wer von Macbeth Spukschauer, von Romeo Üppigkeit verlangt, der hat das Recht, seine Gefühle ungemischt auf kinematischem Wege zu geniessen.
Die Frage, ob heutige ernsthafte Theater durch die mechanistische Konkurrenz Einbusse erleiden, mögen die Praktiker entscheiden. Die Frage ist eine geschäftliche, bis auf den Punkt: können solche Bühnen derart geschwächt werden, dass sie ihre kulturellen Aufgaben nicht mehr zu erfüllen vermögen?
Bisher hat unser Theaterwesen eine künstlerische und eine industrielle Seite; deshalb ist es von den peinlichen Eigenschaften nicht verschont, die allen Grenzgebieten anhaften: mögen sie zwischen Kunst und Geschäft, zwischen Geschäft und Religion, zwischen Politik und Kunst, zwischen Religion und Politik, und so fort in hundert Variationen liegen. Durch geschäftliche Not und Konkurrenz glauben auch ernste Bühnen sich gezwungen, neben Werken der Dichtkunst Unterhaltungs- [Unterhaltungsstücke] und Vergnügungsstücke zu spielen. Die Scheidung zischen Kunstübung und Belustigung, von der Musik längst vollzogen, ist hier kaum begonnen.
Diese Scheidung wird der Kinematograph beschleunigen. Eine Anzahl von Theatern wird zwischen Kunst und Geschäft zu wählen haben, einige werden vielleicht verschwinden. Die Bühnen, die der reinen Kunst sich widmen, werden gestärkt aus dem Kampf hervorgehen. Die Kinos werden, wie Leierkasten, Karussell, Menagerie, Schaubude, Phonograph bestehen, Glück und Abstieg erleben, neue Reizungen vorbereiten und in Afrika enden.
Alles, was aus natürlichen Gründen sich ereignet, hat sein Gutes. Eine Realität, die nicht durch Gewalt und Willkür erzwungen, im Laufe der Dinge entsteht, bringt letztlich keinen Schaden.
[>>] Wilhelm Schäfer.
Wenn Sie in Ihren Ausführungen auf das "Kino" den Ausdruck Schundliteratur anwenden, so ist damit der Zustand nicht übel angedeutet; denn wie man des Schundes wegen nicht gleich gegen die Literatur überhaupt vorgehen kann (obschon das gegen Richard Dehmel und andere von Staatsmoral und Polizei wegen geschah) wird man auch das Kino leben lassen müssen: obwohl auch da - genau wie in der Literatur - das Volk einen erheblichen Instinkt für den Schund hat. Dass die Vorführungen naturgeschichtlicher Art von hohem Wert und die geographischen mindestens nicht wertloser sind, als was unsere illustrierten Familienblätter den Lesern bieten, werden die Gegner des Kino nicht bestreiten. Und dass es auch in den Handlungsfolgen beim Kino Möglichkeiten gibt, die weder das Theater noch eine andere Kunst zu bieten vermag, davon sah ich zufällig - ich bin ein seltener Gast der Kinos - in Bern ein lustiges Beispiel. Zwei Gassenjungen drehen, während der dazugehörige Arbeiter sein Schnäpschen trinken gegangen ist, den Hydranten auf, dass der mächtig bohrende Strahl durchs Fenster der ersten Etage hinein Decke um Decke durchbohrt, und schliesslich mit der Spritze seiner Kaskaden aus dem Dach quillt, was in den überschwemmten Zimmern und Treppen natürlich zu den drolligsten Situationen führt. Ich habe keinen Sinn für Operetten und Possen: aber diese Drolligkeit hat mich herzlich lachen gemacht, und ich wüsste ausser dem Stift eines Zeichners kein Mittel, dergleichen darzustellen; und der würde nicht ausreichen.
Gerade in der blitzschnellen Folge von Situationen, glaube ich, könnte das Kino eine ihm eigentümliche Art von Handlung entwickeln - wenn ihm nicht die "tiefere Bedeutung", die "Moral" usw., ein Bein stellen. Davon sah ich im selben Kino allerdings ein Beispiel: die vier Teufel von Bang wurden in ihren Situationen darstellt; also ein Versuch, das Kino "zu heben". Er war so, dass ich den Raum bald verliess. Aber nun bitte ich zu bedenken: wo war der Kitsch in dem Fall? Wirklich allein beim Kino und nicht auch ein bisschen bei Hermann Bang, dem berühmten Autor? Ich könnte Ihnen Dutzende von "berühmten" Romanen der Gegenwart nennen, die nichts als Kinofolgen, getränkt mit Moral sind. Ziemlich alle Lieblingsautoren des deutschen Volkes - ich rede nicht von Dichtern - sind eben Kinematographen; und dieser Zustand reicht bis in die Schriften literarischer Berühmtheiten hinein, die mit unentwegter Geschicklichkeit für dieselbe simple Liebesaffäre in "Börsenkreisen", in Japan, im Engadin, beim Militär und in "grauer Vorzeit" das interessante Milieu, will sagen die Kinofolge, für das Publikum suchen. In der masslosen Beliebtheit des Kino tritt eigentlich nichts zutage, als was das "Volk" in der Literatur eigentlich sucht und zwar im Theater wie im Buch.
Natürlich ist das kein Grund, sich des entfesselten Instinktes zu freuen; aber auch nicht , um etwa das Theater im ganzen gegen das Kino auszuspielen. Wenn auf der Münchener Hofbühne der Richard Wagnersche Schwan im "Lohengrin" richtig den Hals bewegt und sich Federn ausrupft, oder wenn die Rheintöchter im angeblichen Wasser zappeln; ist das schönste Kino im Gang, vom "Raub der Sabinerinnen", vom "Husarenfieber
gar nicht zu reden. Oder glauben Sie nicht, dass alles, was in "Glaube und Heimat" so spannend und ergreifend auf das deutsche Volk gewirkt hat, oder der beliebte "Rosenkavalier" sich ohne weiteres als Kino darstellen lässt? Das Theater und namentlich das Opernwesen, das "Gesamtkunstwerk" hat dem Kino so viel vorweg genommen, dass man vorsichtiger sein sollte. Und - die "Bahnhofslektüre"? Glauben Sie nicht, dass ein Kampf dagegen grundsätzlich nicht genau so gut begründet werden könnte, wie gegen das Kino?
Der Dichter und der Musiker sind gefährdet; aber mit oder ohne Kino gleichviel, weil der Rohinstinkt für Sinnbildlichkeit nur den bescheidensten Massstab verträgt und alles, um was in den Künsten gerungen wird, sich in einer bedrückenden Einsamkeit vollzieht. Ich trete keinem Werk der Kunst zu nahe, wenn ich behaupte, dass überall, wo der sogenannte "grosse Erfolg", d. h. der Beifall der Massen in Erscheinung tritt, der Kinoinstinkt im Spiel ist. Als seinerzeit von Scherl die Woche gegründet wurde und sich ein ähnlicher Protest wie heute gegen das Kino erhob, habe ich mich und andere damit getröstet, dass sich dadurch der Ungeschmack in unsern Familienblättern zum Extrem auslaufen und den Sinn für eine ernsthafte Revue wieder stärken würde. Das Gegenteil ist eingetreten: die Familienblätter haben sich nach Scherlschem Vorbild modernisiert. Drum scheint mir heute die Hoffnung bescheiden, dass das Kino breiteren Kreisen über ihren Ungeschmack die Augen öffnen wird. Die unerwartete Konkurrenz wird den Theaterdirektoren nur nahe legen, sich dem Kinoinstinkt des Volkes ehrlicher und unbehinderter durch gute Musik oder edle Worte anzupassen, oder die Bude zu schliessen, was ich in vielen Fällen nicht einmal für ein Unglück halten müsste.
Bei uns in Deutschland - anderswo kann ich es nicht beurteilen - stehen bei jeder Gelegenheit gleich die hohen und edlen Dinge in Gefahr, weil sie eben als Allgemeingut garnicht vorhanden sind. Unsere Kultur steht auf so wenig Augen, Ohren und Herzen, dass bei jeder Gelegenheit die blödeste Barbarei zum Vorschein kommt. Wie ich unsern "gebildeten Schichten" kein Recht gebe, gegen die "Schundliteratur des Volkes
aufzubegehren, weil ihre Unterhaltungslektüre nur in den Allüren verändert, von der Dichtung aus nicht gebessert ist: nicht anders stehe ich zum Kino. Ein Volk, dessen Dichter ziemlich ausnahmslos sorgen und hungern müssen, wenn sie sich nicht anderswie (durch einen enervierenden Beruf wie ich, oder wie einige meiner Freunde durch eine reiche Frau) erhalten; es sei denn, dass sie das "Glück" haben, aus dem Kinoinstinkt des Volkes einen "Massenerfolg" zu ziehen: ein solches Volk ist in seinem "gebildeten Teil" nicht so beschaffen, dass es den "Ungebildeten
den Besuch des Kinos missgönnen dürfte.
[>>] Professor Dr. Paul Schubring.
Herr Redakteur! Ihr Aufsatz enthält viele gute und beherzigenswerte Gedanken über den Kinematographen; ich kann fast in allem zustimmen. Nur über die belehrende und orientierende Seite der Bildreihe denke ich noch skeptischer. Wenn der Apparat von der Wissenschaft oder Volkshochschule in systematischer Weise verwandt wird, ist er gewiss an seinem Platz und wichtig. Sonst aber taugen diese zufälligen, unvorbereiteten und schnell wieder verdrängten Belehrungen sehr wenig; sie verwirren und machen hungrig ohne zu sättigen. Es wird bei uns schon viel zu viel "orientiert"; es wird viel zu viel Stoff angeboten, der natürlich nur kurz und oberflächlich behandelt werden kann. Die gesündeste Neugierde muss da bald verelenden. Dies schnelle und bequeme Orientieren aber hindert die Menschen, sich überhaupt noch in eine Sache hineinzuknien, Widerstände zu lieben und Schwierigkeiten zu suchen, deren Überwindung allein eine tiefere Befriedigung verschafft. Wir sind seit 1870 immer oberflächlicher geworden, und nun kommen Apparate, die dies Gift auch noch systematisch ausbreiten. Eine Folge des Kinos ist z. B. die Tatsache, dass keine Bücher mehr gelesen werden; denn wer sich an diese Form der Unterhaltung gewöhnt hat, der findet es langweilig, sich daheim mit einem Buche zu vergnügen.
Aus Reisen gehe ich abends öfter in ein Kinema, da man da nichts Rechtes anzufangen weiss. So habe ich eine ganze Reihe Eindrücke gehabt; aber nur zwei Sachen machten Eindruck. Die eine war eine Folge Dantescher Infernobilder, die andere ein Stiergefecht, bei dem man den Stier prachtvoll zusammenbrechen sah. Wieviel Enttäuschungen und Albernheiten musste ich aber in den Kauf nehmen, um diese zwei guten Erinnerungen zu haben! Neunzehntel aller Stücke lebt von der billigsten Sentimentalität, die den Kleinbürger zwar beglückt, aber nicht besser macht. Alle starken Sachen, die aufrütteln oder imponieren könnten, werden von der Behörde aus den komischsten Gründen verboten. Wäre hier nicht einmal Gelegenheit, schöne nackte Menschen in Bewegung zu zeigen und dem Philister Respekt vor dieser Welt beizubringen? Ich sollte denken, das könnte ihn ein wenig vom Schmutz säubern. Aber da kommt die Polizei mit einem Paragraph. Ich sah historische Szenen, aber die waren so entstellt und maskiert, wie eine restaurierte Burg. Wenn die Passionsgeschichte trotz toller Sachen im Kinema nicht totzubekommen ist, so ist das ein Zeichen von ihrer Unverwüstlichkeit, selbst in den Händen von Wichten. Der "Wochenzettel" ist gerade so übel wie die "Woche", schlimmer als der krasseste Unflat. Denn das Wichtige, Erschütternde, Ewige grosser Begebenheiten wird von der Kamera doch nicht erfasst, wir bekommen ein übles quid pro quo, und das bringt uns auch noch um den letzten Respekt.
Dass heute in Deutschland die Mehrzahl der Theaterbesucher nicht im Stande sind, die geistige Wölbung eines Dramas zu fassen, ist leider Tatsache. Aber das wird wieder anders werden. Vor 1870 war es anders. Sollen wir kondeszendieren? Vielmehr muss alles erstickt werden, was den Menschen um seine innere Ruhe und um seine herzliche Empfänglichkeit bringt, was ihn betäubt, statt ihn zu erheben, was ihn verwirrt, statt ihn zu fördern. Der Hungrige wird den Weg zu nahrhafter Kost zurückfinden, Wir wollen herzhaft lachen, wir wollen innerlich traurig werden im Theater, kleine Empfindungen sollen in die Höhe gebracht, laue Temperatur soll erhitzt werden. Um zu solcher Katharse zu gelangen, müssen wir alles Störende abhungern. Vor allem das Kinema
[>>] Direktor Dr. Georg Swazenski
Wenn durch den Buchdruck Kolportageromane und Pornografika verbreitet werden, so spricht das nicht gegen den Buchdruck, und wenn im Kino üble Sensationen vorgeführt werden, so spricht das nicht gegen das Kino, sondern gegen die Instinkte der Menschen, die solche Sensationen suchen.
Das Kino stellt in der Billigkeit und Bequemlichkeit seiner Benützung, in der Vielseitigkeit und Aktualität seiner Darbietungen die Rekordleistung unter den öffentlichen Unterhaltungen dar. Als eine solche muss man ihn betrachten, und die Frage kann nur die sein, ob er in seinen Wirkungen besser oder schlechter ist, als andere öffentliche Veranstaltungen, die diesem Zwecke dienen.
Bei der Kritik des Kino wird zumeist die fatale Verquickung von höheren und niederen Tendenzen besonders gerügt. Aber diese unreinliche Verquickung ist keineswegs dem Kino eigentümlich, sondern typisch geworden für alle Veranstaltungen dieser Art, - eine Konsequenz der modernen Kommerzialisierung aller Leistungen. Die verschiedensten Unternehmungen, die der Unterhaltung, dem Vergnügen oder rein materiellen Bedürfnissen dienen, haben sich auf die Spekulation mit den leeren Bildungsinteressen, künstlerischer oder wissenschaftlicher Art, eingelassen, wie umgekehrt wissenschaftliche und künstlerische Veranstaltungen weniger denn je sich scheuen, in Zusammenhang mit wirtschaftlichen Unternehmungen niederer Tendenz zu treten, oder sogar den Charakter von solchen anzunehmen. Man denke an die heitere Entwicklungsreihe vom Cabaret mit Sektkonsum bis zur historisch-ästhetischen Conférence, mit der jetzt Damenschneider, Wäsche- [Wäschefabrikanten] und Korsettfabrikanten ihre neuesten Schöpfungen vorführen
Es ist weiter dem Kino vorzuwerfen, dass er seinem ganzen Wesen nach statt des Ursprünglichen und Originalen nur das Surrogat gibt. Aber, - es ist ungerecht, das gerade dem Kino gegenüber so tragisch zu nehmen, da das Surrogat doch heute in Kunst und Wissenschaft ganz allgemein herrscht, - herrschen muss, da sich Kunst und Wissenschaft ja garnicht an einen bestimmten Kreis von Menschen wenden, die durch Begabung oder Erziehung Verständnis dafür haben, sondern an Jedermann. Wo wird heute eigentlich noch wirkliche Kunst um ihrer selbst Willen der Öffentlichkeit geboten?
Man wird bei der Beurteilung des Kino immer davon ausgehen müssen, dass das natürliche Schaubedürfnis der Menge, das im modernen Leben kaum mehr auf seine Rechnung kommen kann, seine Befriedigung dort suchen wird, wo es sie am bequemsten und billigsten findet. Und man darf nie vergessen, dass dieses Schaubedürfnis zu den glücklichen Instinkten der Menschheit gehört, da schöpferische Phantasie und andere produktive Kräfte unlöslich mit ihm verbunden sind. Das Schaubedürfnis gerade der breiten Masse ist aber - allem Snobismus zum Trotz und unabhängig von aller Volksbeglückung - eine Angelegenheit von grosser Bedeutung, weil in ihr zahllose unverbrauchte und unverbildete Kräfte schlummern.
Das Schaubedürfnis der Menge bewegt sich naturgemäss auf der Grenze einerseits zur Sensations- [Sensationslust] und Vergnügungslust, andererseits zum Wissenstrieb und einer primitiven Art künstlerischen Erlebens. Das Kino, als erstes Wunderkind modernster Technik, kann nach allen diesen Richtungen hin entgegenkommen. Aber je nachdem wird seine Wirkung eine verschiedene sein und von verschiedenem Werte.
Was da zunächst das Kino als Vergnügungsanstalt betrifft, so liegt das Bedenken auf Seiten des Sensationellen und Erotischen. Ohne die erschöpfende Materialkenntnis einer Zensurbehörde zu besitzen, scheint es mir doch pedantisch und übertrieben, die moralischen Gefahren, die im Kino lauern sollen, höher zu veranschlagen, als tausend andere Dinge, die dem unmündigen, dem Provinzler und dem Anormalen zur Gefahr werden können. Wer sich für die Angelegenheiten der Massen interessieren will, muss auch an die guten und starken Instinkte der Massen glauben.
Was schliesslich das Kino als Bildungsanstalt betrifft, so muss man scheiden zwischen der wissenschaftlichen und der künstlerischen Seite seiner Bestrebungen und Ambitionen. Dass das Kino in wunderbarster Weise geeignet ist, Wissensstoffe zu vermitteln, den Wissenskreis zu vergrössern und lebendig zu gestalten, ist unbestreitbar. Gewiss: er wird das gesprochene und gedruckte Wort nicht überflüssig machen, und wenn er den Volksbildungsbestrebungen, die gerade auf dem bildenden Wert des Wortes beruhen, wirklich Abbruch tun sollte, so müssen diese eben das Kino in ihre Dienste stellen. Ganz anders steht es dagegen mit der "künstlerischen" Seite der Kinodarbietungen. Nur bei einer vollkommenen Verkennung des Wesens der Kunst kann man überhaupt auf die Vermutung kommen, dass den Kinodarbietungen künstlerische Bedeutung beizumessen sei. Gewiss kann gerade der Künstler selbst aus ihnen lernen: der bildende Künstler kann stoffliche und motivische Anregung aus ihnen ziehen, für den Mimen wäre es lehrreich, einen grossen Schauspieler, den er "im Original" vielleicht nie gesehen hat, wenigstens in der kinematographischen Reproduktion kennen zu lernen, ähnlich wie Grammophonplatten Carusos für den Gesangunterricht benutzt werden. Aber durch diesen Nutzen, den der Künstler aus dem Kino ziehen kann, wird die kinematographische Vorführung noch nicht zum Kunstwerk! Denn ihre Wirkung beruht gerade in diesen Fällen ausschliesslich auf der lehrhaften, getreuen, mechanischen Wiedergabe eines real Gegebenen. Es ist also nicht anders als die typische Verwechslung von Kunst und Wirklichkeit, von Reproduktion und Gestaltung, wenn man dem Kino künstlerischen Gehalt beimisst, und die unkünstlerische Wirkung des sogenannten "dramatischen Films" beruht gerade darauf, dass in ihm die Wirklichkeit mit der "Kunst" des Schauspielers ausgewechselt wird. Dass diese, offenbar populärste Art der kinematographischen Darbietung gegen den guten Geschmack geht - abgesehen von der Roheit des Inhalts, kann der Modell stehende Schauspieler bei dem Fehlen des Wertes sich nur durch eine unerträgliche Verstärkung der Augen- [Augensprache] und Gebärdensprache verständlich machen - ist noch das kleinere Übel. Denn die blosse Hebung des Geschmacks ist keineswegs das wichtigste Ziel der Bemühungen, die darauf abzielen, künstlerische Werte der breiten Massen zu vermitteln. Der eigentliche Sinn all dieser Bestrebungen und Versuche kann nur der sein, durch die öffentliche Darreichung des Kunstwerks das Gefühl für die hohen schöpferischen, gestaltenden und formenden Kräfte zu wecken und zu stärken. Unter diesem Gesichtspunkt ist eben der "dramatische Film" von grösstem Übel.
Was man dagegen tun kann? Ich wüsste nichts anderes, als was die "Frankfurter Zeitung" bereits auf diese Frage geantwortet hat: die sogenannten höheren Kunstanstalten, vor allem die Theater, sollen dem Kino keine - Konkurrenz machen auf seinem eigenen Gebiete! Sie sollen verzichten auf das, was der blossen Unterhaltung und Sensation dient und was mit den blossen Mitteln technischer Geschicklichkeit geleistet werden kann. Sie sollen sich mehr als bisher konzentrieren auf das, was ihre höchste Aufgabe ist - was keine Technik und keine Maschine ersetzen kann. Sie sollen, wenn nicht immer die Heiligkeit, so doch stets die Geistigkeit der Kunst zum Ausdruck bringen.
[>>] Intendant Robert Volkner
Ihren vortrefflichen Ausführungen über den Wert und Unwert des Kinos kann ich im allgemeinen nur zustimmen: besonders hat es mich gefreut, das Sie mit aller Deutlichkeit Kino und Kunst als zwei wesensverschiedene, nie zu vereinende Dinge kennzeichnen.
Den verderblichsten Einfluss übt das Kino auf die Massen durch die sogenannten dramatischen Films aus, diese von falscher Sentimentalität triefenden Darstellungen von Schauer- [Schauergeschichten] und Sensationsgeschichten. Sie weisen darauf hin, dass die Polizei nur die Macht habe, hier die allergröbsten Verstösse gegen die Moral zu verhindern, und sie wollen dem Kino die Ehre einer Zensur, wie sie das Theater geniest - der "Genuss" ist allerdings manchmal kein ungetrübter -, nicht erwiesen wissen. Dennoch scheint mir eine Zensur, speziell der "dramatischen" Vorführungen des Kinos unbedingt geboten, ja selbst einer Beschränkung der im Kino zulässigen Darbietungen auf die Wiedergabe nur "bildlicher" Films muss man das Wort reden, soll nicht der Geschmacksverrohung noch weiter Vorschub geleistet werden.
Andererseits sollten, wie Sie selber es verlangen, die Theater allerorten von den Gemeinden so subventiontiert werden, dass sie durch Veranstaltung billigster Volksvorstellungen, in denen gesunde dramatische Kost geboten wird, die Jugend und die unteren Volksschichten wieder stärker anzuziehen vermöchten. Gerade diese Kreise wenden sich jetzt in erschreckendem Masse den wie Pilze aus der Erde schiessenden Kinos zu. Dadurch werden die Theater teils schwer geschädigt, teils dazu gedrängt, in bedauerlichem Grade nur der äusserlichen Schaulust und dem oberflächlichen Unterhaltungsbedürfnis des grossen Publikums zu dienen, wollen sie nicht ihre Existenz ganz gefährden.
In der Beschränkung auf die kinematographische Vorführung von Land und Leuten, Zeitereignissen und Naturerscheinungen, kann das Kino ohne Zweifel eine gute, einwandfreie Volksunterhaltung bieten. Das Theater aber wird die Konkurrenz des Kinos auch dadurch bekämpfen müssen, dass es in seiner Wiedergabe der grossen Bühnenwerke der Weltliteratur immer mehr nach einer Darstellung strebt, die durch innere und äussere Stimmungskraft auch das naivste Gemüt irgendwie anzieht und ergreift.
============
Ein Arzt über das Kino. [s. SUED'001]
Im Anschluss an die Äusserungen, mit denen eine Reihe von Schriftstellern, Gelehrten und Künstlern auf unseren Artikel "Vom Werte und Unwerte des Kinos" hin zu Worte gekommen ist (vgl. die Aufsätze im ersten Morgenblatt vom 30. und 31. Mai), möge hier noch das Urteil eines Arztes, des bekannten Tübinger Psychiaters Prof. Dr. Gaupp folgen, der im Juniheft der "Süddeutschen Monatsheften" einen Artikel über "Die Gefahren des Kinos" veröffentlicht, dem wir die nachstehenden Stellen entnehmen: [...] Die körperlichen Schädigungen, die uns heute noch im Kino zugefügt werden, hängen zum grossen Teil mit technischen Mängeln zusammen. Die Blendung und Überanstrengung der Augen, die Belästigung des Ohrs durch das unangenehm rasselnde Geräusch sind im eleganten modernen Kino der Grossstadt schon weit weniger bemerkbar geworden, und man darf hoffen, dass die Technik binnen kurzem dieser Übelstände ganz Herr werden wird. Die Gefahren des Kinematographentheaters sind vor allem auf seelischem Gebiet zu suchen. Manche haften dem Kinematographen als solchem an und sind von der Darstellung komplizierter Bewegungsformen durch die lebende Photographie unzertrennlich; andere hängen nur von dem Inhalt des Dargebotenen ab und sind bei gutem Willen zu vermeiden. Eine länger dauernde Darbietung kinematographischer Bilder erzeugt Müdigkeit und Abspannung, weil der rasche Ablauf sich stets ändernder Bilder und die ausschliessliche Einwirkung der Reize auf das Auge die Aufmerksamkeit enorm anstrengt. Dazu tritt die gemütliche Spannung, die der Inhalt der Stücke häufig erzeugt. Die Übermüdung macht sich namentlich beim Kinde bemerkbar, das viel langsamer auffasst als der Erwachsene, weil es bei dem, was es sieht, viel weniger an Bekanntes und schon Gewusstes anknüpfen kann. [...] Allein der Kinematograph wirkt schädlicher und nervenzerstörender {als die Schundliteratur} durch die zeitliche Konzentration der Vorgänge. Beim Lesen können wir beliebig Halt machen, Kritik üben, uns durch Nachdenken und geistige Bearbeitung von dem drückenden Inhalt des Schundromans befreien. Anders beim Kino. Die rasche Folge der aufregenden Bilder steigert die gemütliche Spannung ins Unerträgliche, es bleibt dabei keine Zeit zum Nachdenken und damit zum psychologischen Ausgleich. Die schauerlichen Stoffe erschüttern namentlich beim Kind und beim sensiblen Menschen das Nervensystem bis zur Qual, aber sie geben uns nicht die Mittel, um uns dieser Angriffe auf unser Seelenleben zu erwehren. Nur wenige Menschen haben so viel sinnliche Phantasie, um beim Lesen die Dinge plastisch vor Augen zu haben; der Kino stellt aber alles leibhaftig vor Augen, und das Milieu begünstigt eine tiefe Suggestivwirkung: Der dunkle Raum, das eintönig summende Geräusch, die Aufdringlichkeit der Bilder schläfern die Kritik ein, und so wird der Inhalt des Dramas zur verhängnisvollen Suggestion für die willenlos hingegebene Psyche des einfachen Menschen. [...] Man beruhige sich nicht mit dem Einwand, die kinematographischen Darbietungen seien zu geschmacklos, um eine tiefere Wirkung auszuüben. Nichts wäre irrtümlicher, als eine solche Annahme. Was dem ästhetisch geschulten Geschmack des Gebildeten fad und ungeniessbar erscheint, was er als groteskes Zeug innerlich unberührt abschüttelt, das kann auf Ungebildete und Kinder einen nervenzerstörenden Einfluss ausüben. Wir Nervenärzte wissen, wie oft ein stark affektvolles Erlebnis die nervöse Gesundheit jugendlicher Menschen gefährdet. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Seelenverfassung eines phantasievollen Kindes, das im verdunkelten Raum des Kino mit fiebernden Pulsen alle Schrecken des Dramas miterlebt, einer tiefen und nachhaltigen Suggestion zugänglich ist. Die Zeitungen melden uns erschreckende Vorkommnisse, bei denen jugendliche Personen das im Kino gesehene Verbrechen in der Wirklichkeit nachahmen wollen. [...]
Remark
Siehe auch: VOBB'070
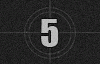
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.