Full Document
Frankfurter Zeitung, 10.09.1913, (auch PELL-009 16. 4.1911)
Gedanken zu einer Ästhetik des "Kino"
Wir kommen aus dem Zustand der Begriffsverwirrungen nie hinaus: etwas Neues und Schönes ist in unseren Tagen entstanden, doch statt es so zu nehmen, wie es ist, als etwas Neues und Schönes, will man es mit allen möglichen Mitteln in alte, unpassende Kategorien einordnen, es seines wahren Sinnes und Wertes entkleiden. Man fasst heute das "Kino" bald als Instrument eines anschaulichen Unterrichts auf, bald als eine neue und billige Konkurrenz der Theater: einerseits also pädagogisch, andererseits ökonomisch. Dass aber eine neue Schönheit eben eine Schönheit ist, dass ihr Bestimmen und Bewerten der Ästhetik zukommt, daran denkt heute kein Mensch.
Ein berühmter ungarischer Dramatiker phantasierte unlängst darüber, wie das "Kino" (durch Vervollkommnung der Technik, durch vollendete Reproduzierbarkeit der Rede) das Theater ersetzen könnte. Wenn dies gelingt - meint er - gibt es kein unvollkommenes Ensemble mehr: das Theater ist nicht mehr an die örtliche Zerstreuung der guten schauspielerischen Kräfte gebunden: nur die besten Schauspieler werden in den Stücken sprechen und sie werden nur gut spielen, denn von Aufführungen, in denen jemand indisponiert ist, macht man eben keine Aufnahmen. Die gute Aufführung wird aber etwas Ewiges; das Theater verliert alles bloss Momentane, es wird zu einem grossen Museum aller wirklich vollendeten Leistungen.
Dieser schöne Traum ist aber ein grosser Irrtum. Er übersieht die Grundbedingung aller Bühnenwirkungen: die Wirkung des tatsächlich daseienden Menschen. Denn nicht in den Worten und Gebärden der Schauspieler oder in den Geschehnissen des Dramas liegt die Wurzel der Theatereffekte, sondern in der Macht, mit der ein Mensch, der lebendige Wille eines lebendigen Menschen, unvermittelt und ohne hemmende Leitung auf eine geradeso lebendige Menge ausströmt. Die Bühne ist absolute Gegenwart. Die Vergänglichkeit ihrer Leistung ist keine beklagenswerte Schwäche, sie ist vielmehr eine produktive Grenze: sie ist das notwendige Korrelat und der sinnfällige Ausdruck des Schicksalhaften im Drama. Denn das Schicksal ist das Gegenwärtige an sich. Die Vergangenheit ist bloss Vorbereitung, bloss Gerüst, im metaphysischen Sinne etwas völlig Zweckloses. (Wenn eine reine Metaphysik des Dramas möglich wäre, eine, die keiner bloss ästhetischen Kategorie mehr bedürfe, so würde sie Begriffe wie " Exposition", "Entwicklung" usw. nicht mehr kennen.) Und eine Zukunft ist für das Schicksal ganz irreal und bedeutungslos: der Tod, der die Tragödien abschliesst, ist das überzeugendste Symbol hierfür. Durch das Dargestelltwerden des Dramas bekommt dieses metaphysische Gefühl eine grosse Steigerung ins Unmittelbare und Sinnfällige: aus der tiefsten Wahrheit vom Menschen und seiner Stellung im Kosmos wird eine selbstverständliche Wirklichkeit. Die " Gegenwart", das Dasein des Schauspielers ist der sinnfälligste und darum tiefste Ausdruck für das vom Schicksal Geweihte der Menschen des Dramas. Denn gegenwärtig sein, das heisst wirklich, ausschliesslich und aufs intensivste leben, ist schon an und für sich Schicksal - nur erreicht das sogenannte "Leben" nie eine solche Lebensintensität, die alles in die Sphäre des Schicksals heraufheben könnte. Darum ist das blosse Erscheinen eines wirklich bedeutenden Schauspielers auf der Bühne (der Duse etwa) selbst ohne grosses Drama schon vom Schicksal geweiht, schon Tragödie, Mysterium, Gottesdienst. Die Duse ist der völlig gegenwärtige Mensch, bei dem nach Dantes Worten das "essere" mit der "operazione" identisch ist; die Duse ist die Melodie der Schicksalsmusik, die klingen muss, wie immer es auch um die Begleitung stehe.
Das Fehlen dieser "Gegenwart" ist das wesentliche Kennzeichen des "Kino". Nicht weil die Films unvollkommen sind, nicht weil die Gestalten sich heute noch stumm bewegen müssen, sondern weil sie eben nur Bewegungen und Taten von Menschen sind, aber keine Menschen. Dies ist kein Mangel des "Kino", es ist seine Grenze, sein principium stilisationis. Dadurch werden die unheimlich lebensechten, nicht nur in ihrer Technik, sondern auch in ihrer Wirkung der Natur wesensgleichen Bilder des "Kino" keinesfalls weniger organisch und lebendig, wie die der Bühne, sie erhalten nur ein Leben von völlig anderer Art: sie werden - mit einem Wort - phantastisch. Das Phantastische ist aber kein Gegensatz des lebendigen Lebens, es ist nur ein neuer Aspekt desselben: ein Leben ohne Gegenwärtigkeit, ein Leben ohne Schicksal, ohne Gründe, ohne Motive: ein Leben, mit dem das Innerste unserer Seele nie identisch werden will, noch kann, und wenn es sich auch - oft - nach diesem Leben sehnt, so ist diese Sehnsucht nur die nach einem fremden Abgrund, wie etwas Fernes und Distanziertes. Die Welt des "Kino" ist ein Leben ohne Hintergründe und Perspektiven, ohne Unterschiede der Gewichte und der Qualitäten, denn nur die Gegenwärtigkeit gibt den Dingen Schicksal und Schwere und Licht und Leichtigkeit: es ist ein Leben ohne Mass und Ordnung, ohne Wesen und Wert: ein Leben ohne Seele, aus reiner Oberfläche.
Die Zeitlichkeit der Bühne, der Fluss der Ereignisse auf ihr ist immer etwas Paradoxes: es ist die Zeitlichkeit und der Fluss der grossen Momente, etwas innerlich tief Ruhiges, beinahe Erstarrtes, ewig Gewordenes, gerade infolge der quälend starken "Gegenwart". Zeitlichkeit und Fluss des "Kino" sind aber ganz rein und ungetrübt: das Wesen des "Kino" ist die Bewegung an sich, die ewige Veränderlichkeit, der nie ruhende Wechsel der Dinge. Diesen verschiedenen Zeitbegriffen entsprechen die verschiedenen Grundprinzipien der Komposition auf Bühne und "Kino": das eine ist rein metaphysisch, alles empirisch Lebendige von sich fernhaltend, das andere so stark, so ausschliesslich empirisch-lebenhaft, unmetaphysisch, dass durch diese seine äusserste Zuspitzung doch wieder eine andere, völlig verschiedene Metaphysik entsteht. Mit einem Worte: das Grundgesetz der Verknüpfung für Bühne und Schauspiel ist die unerbittliche Notwendigkeit, für das "Kino" die von nichts beschränkte Möglichkeit. Die einzelnen Momente, deren Ineinanderfliessen die zeitliche Folge der "Kino"-Szenen zustande bringt, sind nur dadurch miteinander verbunden, dass sie unmittelbar und übergangslos aufeinander folgen. Es gibt keine Kausalität, die sie miteinander verbinden würde; oder genauer: ihre Kausalität ist von keiner Inhaltlichkeit gehemmt und gebunden. Alles ist möglich: dies ist die Weltanschauung des "Kino", und weil seine Technik in jedem einzelnen Moment die absolute (wenn auch nur empirische) Wirklichkeit dieses Moments ausdrückt, wird das Gelten der "Möglichkeit" als einer der "Wirklichkeit" entgegengesetzten Kategorie aufgehoben; die beiden Kategorien werden einander gleichgesetzt, sie werden zu einer Identität. "Alles ist wahr und wirklich, alles ist gleich wahr und gleich wirklich": dies lehren die Bilderfolgen des "Kino".
So entsteht im "Kino" eine neue, homogene und harmonische, einheitliche und abwechslungsreiche Welt, der in den Welten der Dichtkunst und des Lebens ungefähr das Märchen und der Traum entsprechen: grösste Lebendigkeit ohne eine innere dritte Dimension; suggestive Verknüpfung durch blosse Folge; strenge, naturgebundene Wirklichkeit und äusserste Phantastik: das Dekorativwerden des unpathetischen, des gewöhnlichen Lebens. Im "Kino" kann sich alles realisieren, was die Romantik vom Theater - vergebens - erhoffte: äusserste, ungehemmteste Beweglichkeit der Gestalten, das völlige Lebendigwerden des Hintergrundes, der Natur und der Interieurs, der Pflanzen und der Tiere; eine Lebendigkeit aber, die keineswegs an Inhalt und Grenzen des gewöhnlichen Lebens gebunden ist. Die Romantiker versuchten darum das phantastisch Naturnahe ihres Weltgefühls der Bühne aufzuzwingen. Die Bühne ist aber das Reich der nackten Seelen und Schicksale; jede Bühne ist im innersten Wesen griechisch: abstrakt bekleidete Menschen betreten sie und führen vor abstraktgrossartigen, leeren Säulenhallen ihr Spiel vom Schicksal auf. Kostüm, Dekoration, Milieu, Reichtum und Abwechslung der äusseren Ereignisse sind für die Bühne ein blosses Kompromiss: im wirklich entscheidenden Augenblick werden sie immer überflüssig und darum störend. Das "Kino" stellt bloss Handlungen dar, nicht aber deren Grund und Sinn, seine Gestalten haben bloss Bewegungen, aber keine Seelen, und was ihnen geschieht, ist bloss Ereignis, aber kein Schicksal. (Deshalb - und bloss scheinbar wegen der heutigen Unvollkommenheit der Technik - sind die Szenen des "Kino" stumm: was an den dargestellten Ereignissen von Belang ist, wird durch Geschehnisse und Gebärden restlos ausgedrückt, jedes Sprechen wäre eine störende Tautologie.) Dadurch aber erblüht alles, was die abstrakt-monumentale Wucht des Schicksals immer erdrückte, zu einem reichen und üppigen Leben: auf der Bühne ist nicht einmal das, was geschieht, wichtig, so überwältigend ist die Wirkung seines Schicksalwertes; im "Kino" hat das "Wie" der Geschehnisse eine alles andere beherrschende Kraft. Das Lebendige der Natur erhält hier zum ersten Male eine künstlerische Form: das Rauschen des Wassers, der Wind in den Bäumen, die Stille des Sonnenunterganges und das Toben des Gewitters werden hier als Naturvorgänge zur Kunst (nicht, wie in der Malerei, durch ihre aus anderen Welten geholten, malerischen Werte). Der Mensch hat seine Seele verloren, er gewinnt aber dafür seinen Körper; seine Grösse und Poesie liegt hier in der Art, mit der seine Kraft oder seine Geschicklichkeit physische Hindernisse überwältigt, und die Komik besteht in seinem Erliegen ihnen gegenüber. Die für jede "grosse" Kunst völlig gleichgültigen Errungenschaften der modernen Technik werden hier phantastisch und poetisch-packend wirken. Erst im "Kino" ist - um nur ein Beispiel zu bringen - das Automobil poetisch geworden, etwa im romantisch Spannenden einer Verfolgung auf sausenden Autos. So erhält hier auch das gewöhnliche Treiben der Strassen und Märkte einen starken Humor und eine urkräftige Poesie: das naiv-animalische Glücksgefühl des Kindes über einen gelungenen Streich, über das hilflose Nichtzurechtfinden eines Unglücklichen wird in unvergesslicher Weise gestaltet.
Die Naturwahrheit "Kino" ist aber nicht an unsere Wirklichkeit gebunden. Die Möbel bewegen sich im Zimmer eines Betrunkenen, sein Bett fliegt mit ihm - er konnte sich noch im letzten Augenblick am Rande des Bettes festhalten und sein Hemd weht wie eine Flagge um ihn - über die Stadt hinaus. Die Kugeln, mit denen eine Gesellschaft Kegel schieben wollte, werden rebellisch und verfolgen sie über Berge und Felder, durch Flüsse schwimmend, auf Brücken springend und auf hohen Treppen hinaufjagend, bis endlich auch die Kegel lebendig werden und die Kugeln abholen. Auch rein mechanisch kann das "Kino" phantastisch werden: wenn die Films in umgekehrter Reihenfolge gedreht werden und Menschen unter den sausenden Autos aufstehen, wenn ein Zigarrenstummel durch das Rauchen immer grösser wird, bis schliesslich im Moment des Anzündens die unberührte Zigarre in die Schachtel zurückgelegt wird. Oder man dreht die Films um, und seltsame Lebewesen agieren da, die vom Plafond plötzlich in die Tiefe schnellen und sich wie Raupen dort wieder verkriechen. Es sind Bilder und Szenen aus einer Welt, wie die von Hoffmann oder Poe war, wie die von Arnim oder von Barbey d' Aurevilly - nur ist ihr grosser Dichter, der sie gedeutet und geordnet, der ihre bloss technisch zufällige Phantastik ins sinnvoll Metaphysische, in den reinen Stil gerettet hätte, noch nicht gekommen. Was bis heute entstanden ist, entstand naiv, oft gegen den Willen der Menschen, nur aus dem Geiste der Technik des "Kino": ein Arnim oder ein Poe unserer Tage würde aber für seine szenische Sehnsucht hier ein Instrument bereit finden, so reich und so innerlich adäquat, wie es etwa die griechische Bühne für einen Sophokles war.
Remark
auch PELL-009 16.4.1911
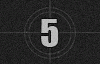
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.