Full Document
Dürer-Bund, 21.05.1912, 100. Flugschrift zur Ausdruckskultur
Der Kinematograph vom medizinischen und psychologischen Standpunkt. / Der Kinematograph als Volksunterhaltungsmittel
Vorträge gehalten am 21. Mai 1912 in Tübingen
Der Kinematograph vom medizinischen und psychologischen Standpunkt.
Vortrag von Prof. Dr. Robert Gaupp
Der Kinematograph oder Biograph ist eine der wundervollsten technischen Erfindungen der Neuzeit, einer der interessantesten Fortschritte auf dem Gebiete der photographischen Wiedergabe des Lebens in all seiner Mannigfaltigkeit. Was kein Zeitalter vor uns gekonnt hat, das ist mit ihm möglich geworden: der Ablauf der Naturvorgänge, die Bewegungen alles Lebendigen und die Handlungen der Menschen der Mitwelt objektiv getreu zu schildern und der Fachwelt zu stets möglicher Reproduktion zu überliefern. Die Wissenschaft verdankt ihm schon heute manche wertvolle Bereicherung, die Geschichtschreibung der Zukunft wird sich seiner bedienen, wenn sie das kulturelle Leben unserer Zeit erfassen will. Lemke hat den Film das Buch der menschlichen Handlung genannt und ihn der bedruckten Papierrolle als dem Buch der menschlichen Gedanken an die Seite gestellt. Die Naturwissenschaft erkennt mit jedem Tage deutlicher, was sie Professor Marey, dem eigentlichen Begründer der modernen Kinematographie, zu verdanken hat.
Aber nicht von diesem Kinematographen soll heute hier die Rede sein, sondern von dem Kinematographentheater, dem modernen Unterhaltungsmittel, das in raschem Siegeslauf die ganze Welt erobert, in grossen Städten pilzartig aus dem Boden schiesst und dank seiner Einfachheit überall eindringt. Von dem Volkstheater der Gegenwart, dem "Kino" oder "Kientopp" wollen wir zu Ihnen sprechen, von seiner Bedeutung für unser Volk, von seinen Gefahren für Kultur und Gesittung.
Lumière hat vor sechzehn Jahren dem Kinematographen die Form gegeben, in der er aus der Stille der wissenschaftlichen Forschung auf den Markt des öffentlichen Lebens hinaustreten konnte. Anfänglich sah das Publikum nur wenig davon: in grossen Varietés erschienen zuerst am Schluss der Programme einige Darbietungen, meist Naturaufnahmen oder Bilder vom Tage. Im Jahre 1900 hatte Berlin noch kein ständiges Kinematographentheater; 1910 zählte man dort schon 260 Kinos und inzwischen werden es wohl 300 geworden sein. Von den Grossstädten drang es in die kleineren und kleinsten Städte, und heute hat fast jede Stadt von 10000 Einwohnern schon ihr eigenes Kino. Der Zulauf ist enorm. Nach sorgfältigen Berechnungen gehen in Deutschland täglich mehrere Millionen Menschen ins Kino und in Amerika ist der Zulauf noch grösser als bei uns. In Stuttgart gibt es über 20, in Ulm 6, in den kleineren württembergischen Mittelstädten 1-2 solcher Volksbelustigungsstätten. New York zählt über 500 Kinos, das kleine Florenz schon deren 80. Das im Kinematographenwesen engagierte Kapital ist ungeheuer. Die Firma Pathé frères in Paris beschäftigt 5000 Personen; wöchentlich werden über 500 Films hergestellt, von denen manche viele hundert Meter lang sind und einzelne 200000 Frank und noch mehr kosten. Über 75 Prozent aller Films stammen vom Ausland; Frankreich steht an der Spitze, dann kommt Amerika, Italien und England, nach ihnen Dänemark und Deutschland. Theater und Konzerte werden durch das Kino immer mehr verdrängt, an vielen Orten waren die Theater gezwungen, den Betrieb einzustellen und sich in Kinos umzuwandeln. Die bekanntesten dramatischen Grössen konnten dem Lockruf der Filmfabrikanten nicht wiederstehen [widerstehen] und liessen sich von ihnen anwerben. Honorare von märchenhafter Höhe werden berühmten Schauspielern und Tänzerinnen bezahlt; der Komiker Max Lindner bezieht aus seiner Tätigkeit für die Kinos eine Jahresgage von 100000 Frank. (Mitteilung der "Frankfurter Zeitung".) [Verweis &1] Ein Kinotheater, das mit einem Kapital von 700000 Mark gegründet wurde, soll im ersten Jahr ein Reineinkommen von 800000 Mark gehabt haben.
Wir müssen beim Kinematographenwesen drei Kategorien von Unternehmern unterscheiden: die Filmfabrikanten, die Verleihinstitute und die Theaterbesitzer. Selbstverständlich ist die letzte Gruppe von den ersten beiden durchaus abhängig; die Programme werden den Theaterbesitzern zum grossen Teil in fertiger Zusammenstellung geliefert; das ist der Grund, weshalb das Programm einer Kinovorstellung in seinem ganzen Aufbau fast überall gleichartig ist: Einige Naturaufnahmen, einige Bilder vom Tage, ein oder zwei humoristische Szenen und zwei Dramen. Ein Blick auf die Programme, die in verschieden grossem Druck und in verschiedener Umrahmung die einzelnen Nummern aufführen, und namentlich ein Blick auf die Plakate am Fenster und Eingang des Kinos lehren sofort, auf welchen Nummern der Nachdruck liegt, was die "Kassenmagnete" bildet, womit das Publikum angelockt und eingefangen wird.
Dieses Publikum setzt sich aus Erwachsenen und Kindern zusammen. Manche Kinos schreiben auf ihre Programme: Nur für Erwachsene, lassen aber trotzdem auch alle Kinder zu und erhoffen sich von dieser Bezeichnung nur eine stärkere Anziehungskraft auf die Menschen, die das Pikante und Zweideutige oder Unanständige mit besonderer Gier aufsuchen. Unter den Erwachsenen dominieren die einfachen Leute. Am Sonntag wimmelt es von Soldaten und Dienstmädchen; das Alter von 10 bis 20 ist besonders stark vertreten. Man hat das Kino das "Theater des kleinen Mannes" genannt. Es ist dies in der Tat namentlich durch seine Billigkeit geworden. Die Preise schwanken zwischen 20 Pfennig und 1 Mark; elegante Grossstadtkinos haben auch teurere Plätze bis zu 5 Mark.
Fragen wir uns nun: Woher kommt dieser ganz unerhörte Erfolg, dieser förmliche Siegeszug des Kinos, der zum beliebtesten Unterhaltungsmittel unseres Volkes geworden ist? Eine Ursache habe ich soeben genannt, das ist seine Billigkeit. 20 bis 50 Pfennig auszugeben fällt unserem Volke trotz allem Geschrei über die hohen Steuern nicht schwer. Zur Billigkeit kommt die Bequemlichkeit. Im Kino wird von nachmittags 3 oder 4 Uhr ab ununterbrochen gespielt, man kann jederzeit kommen, jederzeit gehen, muss nicht warten; das Programm ist in 1-2 Stunden erledigt, es gibt keine langweiligen Pausen. Die einzelnen Nummern sind von kurzer Dauer, es herrscht Mannigfaltigkeit; Scherz und Ernst kommen zu Wort, es wird viel geboten und Sie kennen ja die Worte des Dichters:
"Wird vieles vor den Augen abgesponnen, So dass die Menge staunend gaffen kann, Da habt Ihr in der Breite gleich gewonnen, Ihr seid ein vielgeliebter Mann. Die Masse könnt Ihr nur durch Masse zwingen. Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Und jeder geht zufrieden aus dem Haus."
Allein neben diesen äusseren Vorteilen müssen es doch auch psychologische Momente sein, die das Kino zum Volkstheater unserer Zeit machen. Auf sie möchte ich mit einigen Worten eingehen.
Die Auffassung der Aussenwelt mit dem Auge ist müheloser als die mit dem Ohre, das Sehen fällt uns leichter als das Zuhören. Solange wir wach sind, ist unser Auge tätig; es ist an grössere Arbeit gewöhnt als unser Ohr. Der müde Kopf vermag noch ein Bilderbuch zu beschauen, aber nicht mehr einen Text zu studieren oder einer Erzählung zuzuhören. Alles, was auf dem Wege der Sprache und Schrift zu uns kommt, verlangt mehr Mitarbeit von uns, um verstanden und gewürdigt zu werden, als was uns auf optischem Wege in Bildform unmittelbar vor Augen tritt. Theater und Konzerte, Vorträge und Reden verlangen mehr Nachdenken und geistige Mitarbeit als Bilder und Geschichten, die uns durch Bilder vermittelt werden. Die Mühelosigkeit des Genusses verschafft dem Lichtspiel seine Beliebtheit. Dazu kommt, dass uns alles, was uns leibhaftig vor Augen tritt, gemütlich weit leichter und tiefer packt als das, was wir lesen und uns nun erst mittels der Phantasie vorstellen, d. h. doch wohl vor Augen stellen müssen. Der Kino nimmt uns also diese Mühe von vornherein ab; er lässt das Leben sich vor unseren Augen abspielen, ohne dass wir genötigt wären, durch Anstrengung unserer Phantasie den Inhalt aktiv zu erfassen und Stellung zu ihm zu nehmen. Weiterhin: alle unsere höhere Kultur ist an das Wort gebunden; ohne Worte ist kein kompliziertes geistiges Geschehen verständlich zu machen. Dem Kino fehlt das Wort bei der Charakterisierung seines Inhaltes; damit ist ihm die Möglichkeit genommen, komplizierte seelische Probleme darzustellen, er muss sich ganz naturgemäss auf die Darstellung der elementaren seelischen Vorgänge, der einfachen Gefühle und Leidenschaften beschränken, die sich einer Wiedergabe nur durch Bewegungen fügen. Ein Drama von Ibsen wäre auf dem Kino völlig unverständlich; die kinematographische Wiedergabe klassischer Dramen bildet eine unsinnige Verirrung, an der niemand Geschmack und Gefallen findet. Indem aber der Kino nur einfache, leicht verständliche Dinge vorführt und indem er diese, um verständlich zu sein, vergröbert, ja geradezu karikiert, nähert er sich dem Geschmack des ungebildeten, des primitiven Menschen, der starke Kontraste und heftige Gemütsbewegungen liebt, gerne in rührseliger Stimmung schwelgt, das Sentimentale und das Grauenvolle, das Düstere und Gruselige, das Groteske und Derbkomische, das Phantastische und das Schwül-sinnliche bevorzugt, während er den gedankenreichen Dichtungen, den gedämpften Gefühlen, wie sie die Kunst unserer Zeit auslöst, verständnislos oder gleichgültig gegenübersteht. Müheloses Geniessen ohne geistige Mitarbeit, Aufrühren der Gefühle elementar-einfacher Natur: das verlangt der undifferenzierte Besucher vom Volkstheater, und diesem Verlangen kommt der Kino am besten entgegen. Daraus erklärt sich sein Sieg über alle anderen Formen der Volksunterhaltung.
Aber was seinen Sieg bedingt, das bedingt auch seine Gefahren, und diese Gefahren und Schäden des modernen Kinematographentheaters sind es, die uns veranlagt haben, am heutigen Abend in öffentlicher Versammlung zu dem Kino, wie er heute bei uns in Deutschland allerorts auftritt, Stellung zu nehmen. Mir, dem Arzte und Psychologen, fällt dabei die Aufgabe zu, Ihnen darzulegen, ob und inwieweit der Kino der körperlichen und geistigen Gesundheit unseres Volkes, vor allem unserer Jugend, gefährlich geworden ist, während Kollege Lange Ihnen darlegen wird, welche Schäden dem sittlichen Gefühl, der Kunst und dem Geschmack angefügt werden.
Ich beginne mit den Gefahren für die körperliche Gesundheit. Der Kino der kleinen Stadt ist noch manchmal ein dumpfes, schlecht ventiliertes Lokal mit stickiger Luft, ein muffiger, manchmal feuergefährlicher Raum, dessen Dunkel nur in den Pausen durch ein spärliches Licht etwas erhellt wird. Unter dem Einfluss der Polizei und bei der guten Rentabilität des Unternehmens sind diese Mängel heute bereits viel seltener anzutreffen als im Beginn der Ära des Kinos, und ich möchte gegenwärtig den Schaden, den das Milieu dem Besucher zufügen kann, nicht mehr hoch einschätzen, zumal es sich ja meist nur um einen Besuch von 1 bis 2 Stunden Dauer und ausserdem um ein Publikum handelt, das oft weder in seinen eigenen Wohnungen, noch auch in der sonst gewählten Bierstube günstigere hygienische Bedingungen vorfindet. Selbstverständlich ist es vom Übel, wenn Schulkinder die freien Nachmittagsstunden, die dem Aufenthalt im Freien dienen sollten, im Kino zubringen. Das Flimmern und Wackeln der Bilder blendet und schädigt die Augen des Beschauers ganz zweifellos, und es ist mir von verschiedenen Besuchern des Kinos über schmerzhafte Empfindungen in den Augen und im Kopfe geklagt worden; auch wurde wiederholt von Ärzten auf diese Überanstrengung der Augen hingewiesen. Das Übel hängt mit der technischen Unvollkommenheit des Apparates zusammen; ein eleganter moderner Grossstadtkino bester Konstruktion erzeugt weit weniger ein störendes Flimmern als die schlechten Apparate, die wir in unseren kleinen Städten haben. Bei empfindlichen Augen kann sich das schmerzhafte Blendungs- [Blendungsgefühl] und Ermüdungsgefühl mit leichten Schwindelempfindungen verbinden. Primitive Kinos fügen diesem Übel noch ein irritierendes Geräusch und eine unerfreuliche Musik hinzu, die ebenfalls nicht geeignet ist, das körperliche Wohlbehagen zu erhöhen.
Diese bisher genannten Unzuträglichkeiten sind vermeidbar und im guten Kino auch schon fast ganz vermieden; ich erwähne sie mehr nur deshalb, weil der Kino immer mehr auch in kleine Städte vordringt, wo er natürlich nur in primitiver, technisch mangelhafter und damit auch gesundheitlich unzuträglicher Form auftritt.
Bedeutungsvoller sind die Schäden des Kinematographentheaters, so wie es heute ist, für die seelische Gesundheit des Menschen, vor allem des jugendlichen Menschen. Manche dieser Schäden erscheinen mir von der kinematographischen Darstellung komplizierter Bewegungsformen unzertrennlich, während andere nur von dem Inhalt des Dargebotenen abhängen und an sich wohl zu vermeiden sind.
Wenn wir eine ein- [einstündige] bis zweistündige Vorstellung im Kino über uns ergehen lassen, und wenn wir uns dabei bemühen, alles Gebotene aufzufassen und zu verstehen, so sind wir nachher müde und abgespannt, wozu bei widerwärtigem Inhalt noch ein moralischer Widerwille hinzukommen kann. Müdigkeit und Abspannung entstehen einmal durch die Überanstrengung der Augen bei dem raschen Ablauf der Bilder, durch die rein optische Reizgebung bei Ausschluss der anderen Sinnesorgane (im Unterschied z. B. von einem Theaterstück oder einem Lichtbildervortrag). Wer folgen will, muss seine Aufmerksamkeit enorm anstrengen; das Bestreben, in dem rasch sich ändernden Bild alles Detail aufzufassen, die Unmöglichkeit, bei Wichtigem länger zu verweilen, oder unklar Gesehenes sich wiederholen zu lassen, all diese Übelstände zwingen zu einer krampfhaften Einstellung der Aufmerksamkeit, wenn der Inhalt komplizierter, detailreicher Natur ist, also vor allem bei den belehrenden Films. Je komplizierter das ganze Bild, je zahlreicher die dargestellten Personen oder Gegenstände, je rascher die Bewegungen, desto schwieriger wird die geistige Erfassung seines Inhaltes. Wer also aus kinematographischen Darstellungen fremder Länder und Sitten, naturwissenschaftlicher und technischer Vorgänge wirklich etwas lernen will, muss sich geistig ausserordentlich anstrengen. Der gebildete Mensch mit rascher Auffassungsfähigkeit, der schon viel gesehen hat, wird das weniger empfinden, als das Kind, das viel langsamer auffasst und begreift, weil es ja bei dem, was es zu sehen bekommt, viel weniger an schon Bekanntes und längst Gewusstes anknüpfen kann. Kein Kind kann die enorme Anstrengung der Aufmerksamkeit, die zur wertvollen Erfassung des Inhaltes belehrender Films nötig ist, für längere Zeit aufbringen, ohne zu übermüden. Man mache sich deshalb darüber keine Illusionen, dass die mehr belehrenden Nummern im Kino so, wie sie dort zurzeit dargeboten werden, für den Ungebildeten und das Kind immer langweilig sind, und zwar nicht etwa bloss deshalb, weil diese Personen ästhetisch noch zu ungeweckt sind, sondern aus dem ganz einfachen physiologischen Grunde, weil es ihnen unmöglich ist, in raschem Flug die geistige Arbeit zu bewältigen, die in der scharfen Beobachtung und geistigen Erfassung kurzzeitiger Bewegungsbilder aufgebracht werden muss. Ich lege auf diese Tatsache den allergrössten Nachdruck. Wenn wir Erwachsenen sehen und beobachten, so ergänzt unsere Seele aktiv aus dem Bestande unseres Wissens, unserer inneren Anschauung jeden neuen Eindruck; nur so wird es uns überhaupt möglich, das rasch wechselnde Kinobild, dessen Einzelheiten kein Mensch in der kurzen Zeit seines Erscheinens wirklich wahrzunehmen vermag, doch in allem Wesentlichen zu erfassen und zu verstehen. Nun sind aber innere Anschauung und eigenes, bereitliegendes Wissen beim Kinde und beim Ungebildeten meist noch viel zu gering, und so muss ihnen viel von dem entgehen, was der flüchtige Augenblick an Eindrücken bietet. Wer von einer Papierfabrikation oder einem Eisenwerk noch gar keine Ahnung hat, der wird im Kino bei der raschen, wortlosen und farblosen Vorführung von Bildern, die diese Vorgänge darstellen, niemals zu klarem Verständnis kommen; es kann nur ein Schädliches und oberflächliches Halbwissen entstehen. Es ist also nicht bloss psychologisch, sondern auch rein physiologisch ganz natürlich, dass im heutigen Kino die belehrenden Nummern von den Kindern und Ungebildeten gleichgültig hingenommen werden, während der humoristische Film, die Situationskomik und das "Drama" das Publikum entzücken und hinreissen. Denn diese letzteren sind restlos verständlich, auch ohne eine peinliche Anstrengung der Aufmerksamkeit für jedes Detail, und sie sind deshalb verständlich, weil sie Vorgänge schildern, die dem Gedanken- [Gedankenkreise] und Betätigungskreise der Zuschauer auch sonst naheliegen. Einen Lausbubenstreich, eine rührselige Liebesgeschichte, einen Mord und Einbruchsdiebstahl verstehen wir eben im lebenden Bild leichter, als die Darstellung einer Tabaksernte oder eines Sägewerks.
Dazu kommt noch etwas anderes: wer belehrende Films sieht, möchte, wenn er an sich für solche Dinge Interesse hat, doch auch etwas behalten und sich dauernd zu eigen machen. Nun lehrt uns aber die Psychologie, dass die Fähigkeit, optische Eindrücke im Gedächtnis festzuhalten, wesentlich davon abhängt, ob wir die Zeit haben, sie uns auch wirklich einzuprägen und ob den Zeiten des Einprägens Ruhezeiten folgen, in denen die Eindrücke im Gehirn gewissermassen fixiert werden. Je rascher das dargebotene optische Material wechselt, je weniger es durch Wiederholung tief eingeprägt werden kann, desto vergänglicher ist der Eindruck, desto weniger wird behalten. Auch das Kind fühlt und erlebt das sehr bald; es merkt, wie wenig ihm von dem, was in rascher Bilderfolge an ihm vorüberzieht und stofflich schwierig ist, im Gedächtnis bleibt, und so erlahmt sein Interesse an den naturwissenschaftlichen, technischen Films sehr rasch. Man beobachte einmal Kinder und ungebildete Leute im heutigen Kino daraufhin, was sie fesselt. Beim belehrenden Film ohne erklärendes Wort und ohne die, die Auffassung erleichternde Farbe schläft das Kind ein.
Ans dem Gesagten geht also hervor, dass ich, im Unterschied von einer häufig gehörten Ansicht, den Bildungswert belehrender Films in der Darbietung unserer gewöhnlichen Kinos sehr gering einschätze. Ich betone: in der Darbietung unserer gewöhnlichen Kinos, sowie sie jetzt sind. Ich habe mich selbst darauf geprüft: obwohl ich im ganzen eine gute optische Auffassung habe, ist mir doch von den belehrenden Films wenig im Gedächtnis geblieben. Landschaftsbilder, die manchmal recht schön sind, vermochten mich doch nur dann tiefer zu interessieren, wenn ich in ihnen Bekanntes wiedersah, d. h. also, wenn ich aus eigenem Wissen und eigener innerer Anschauung das ergänzen konnte, was ich im Kino dargestellt erhielt. Dem Kinde und dem Ungebildeten ist aber in der Regel noch alles fremd und so wird nicht viel davon bei ihnen tiefer haften können. Und ehe der Eindruck sich festsetzen kann, kommt eine neue Nummer.
Noch aus einem anderen Grunde möchte ich davor warnen, den Bildungswert des im Kino Gesehenen hoch einzuschätzen, wenigstens soweit es sich um die Jugend handelt. So hoch wir ja heutzutage den Anschauungsunterricht stellen, so glaube ich doch, dass das rein passive Verhalten des Kindes im Kino, die Unmöglichkeit, bei dem Aufnehmen des neuen Stoffes aktiv mitzutun, verbunden mit dem Mangel des erläuternden Wortes die Vorführung belehrender Films wenig erfolgreich macht.
Wir leben ja in einer Zeit nervöser Hast und Vielgeschäftigkeit, in der von allen Seiten die mannigfaltigsten äusseren Reize auf die jungen Seelen einstürmen, in der die Jugend so leicht blasiert wird; sollen wir da eine Belehrungsform gutheissen, bei der nur ein flüchtiges oberflächliches Erfassen, ein passives Hinnehmen und ein halbes Verstehen des Gebotenen stattfindet? Die pädagogische Erfahrung lehrt uns, dass wenig sehen, aber das Gesehene geistig tief verarbeiten, beim Erfassen der Aussenwelt aktiv mitwirken, gründliche und willenskräftige Menschen schafft. Aus ruhiger eindringlicher Beobachtung erwächst das selbständige und schöpferische Denken. Zu all dem aber gehört Zeit und immer wieder Zeit. Der Kino hat aber keine Zeit, Bild drängt sich an Bild; die Nummer folgt der Nummer. Soll also der Verflachung des Denkens durch dieses moderne Bildungsmittel entgegengetreten werden, soll ein flüchtiges gedankenloses Hinnehmen des optischen Materials vermieden werden, soll sich Anschaulichkeit mit Gründlichkeit und gedanklicher Verarbeitung vereinigen, so muss die kinematographische Vorführung einen anderen Charakter haben, als sie ihn heute im Kinematographentheater tatsächlich hat. Das vorbereitende und erklärende Wort muss hinzukommen, die Farbe muss die Lebenswahrheit verstärken, das Tempo muss langsamer werden; die Aufmerksamkeit muss schon vorher in bestimmter Richtung orientiert werden. Auch müssen komplizierte Bilder eventuell wiederholt werden. Auf die Vorführung eines Naturvorganges muss eine Pause folgen, die lang genug ist, damit die neuen Eindrücke Zeit haben, sich im Gedächtnisse zu fixieren und sich mit dem übrigen Bewusstseinsinhalt zu einheitlichem Wissen zu verbinden. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt werden, kann der Kinematograph das werden, was viele seiner Freunde wünschen, ein Förderer unseres Wissens, ein Erweiterer unserers [unseres] Blickes, ein Beleber unserer Anschauung von dem Reichtum der lebendigen Wirklichkeit.
Den Gefahren, die der Kino aus rein formalen Gründen in sich birgt, stehen die nun weit grösseren gegenüber, die aus dem Inhalt des Dargebotenen stammen. Man pflegt bekanntlich verschiedene Kategorien von Films zu unterscheiden. Die belehrenden Films geben uns Naturaufnahmen aus dem Gebiet der Landschaft, des technischen und industriellen Lebens, schildern Handel und Gewerbe, die Fortschritte aus dem Gebiet der Wissenschaft; sie führen uns in fremde Länder und Städte, machen uns mit Sitten und Gebräuchen fremder Völker bekannt. Manche von ihnen sind schön und für den Erwachsenen auch interessant; niemand wird sich dem Zauber einer technisch vollendeten Aufnahme des bewegten Meeres oder des galoppierenden Pferdes oder des Vogelfluges entziehen können. Nur wenige der belehrenden Films können in inhaltlicher Beziehung an sich schädlich wirken. Wohl gibt es auch hier Ausnahmen. Man wies mit vollem Recht darauf hin, dass die Vorführung chirurgischer Operationen oder physiologischer Experimente am lebenden Tiere, die für den Gelehrten eine gewisse Bedeutung haben können, im Volkskino schädlich wirken. Der Laie sieht nur die Leiden, die dargestellt sind, versteht aber nicht den tiefen Sinn und Zweck, der diese Leiden ethisch rechtfertig. Gegner des Tierexperimentes, das die Wissenschaft niemals wird entbehren können, arbeiten mit dem Kino, um für ihre Bestrebungen in dieser törichten Weise Stimmung zu machen.
Allein von solchen Ausnahmen abgesehen spielt der belehrende Film inhaltlich für die Frage nach den Gefahren des Kinos keine Rolle. Anders der unterhaltende Film. Wo er nur die Neugierde befriedigt, wie in den Bildern vom Tage, ist er harmlos, manchmal ganz interessant, oft auch herzlich langweilig und durch die Festhaltung gleichgültigen Zeremoniells flach und verflachend. Aber alle diese Nummern eines Kinoprogramms sind ja sehr unwesentlich. Das, was den Kino zum beliebtesten Unterhaltungsmittel unserer Zeit gemacht hat, das sind die hnmoristischen und die sensationellen Films. Sie machen dem Theater Konkurrent, wollen uns gleich ihm Szenen aus dem Leben der Menschen vor Augen führen. Ich habe schon oben dargelegt, dass es psychologische Gründe hat, weshalb das Triviale und Groteske, das Rührselige und das Schauerliche, das Freche und Burleske, die wilde Erotik und das faszinierende Verbrechen den Kino beherrschen. Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass die Filmfabrikation im Dienste des Grosskapitals steht; die unterhaltenden Films werden nur an wenigen Orten der Welt angefertigt und sie gehen von da über die ganze Welt. Sie müssen also dem Amerikaner ebenso gefallen, wie dem Australier, dem Südromanen ebenso wie dem Nordgermanen, dem Japaner ebenso wie dem Franzosen. Daraus ergibt sich bei der relativen Dürftigkeit der Ausdrucksmittel ganz von selbst, dass nur relativ elementare Vorgänge des menschlichen Lebens zum Ausdruck kommen können. Liebe und Hass, Verbrechen und Rache, Spott und Schadenfreude, Furcht und Grauen, kurz alle unkomplizierten Regungen der Menschenseele bilden die Domäne des Unterhaltungsfilms. Die Wirkung dieser gefühlserregendem Stoffe verstärkt sich durch die zeitliche Konzentration der Vorgänge. Was uns der Detektiv- [Detektivroman] und Schundroman in einem dicken Bande an Sensationen schafft, das stellt uns der Kino in 10 bis 15 Minuten konzentriert vor Augen. Die psychologische Wirkung wird dadurch eine ganz andere. Beim Lesen können wir nach Belieben halt machen, am Gelesenen Kritik üben, uns von dem Druck durch Nachdenken innerlich frei machen, das gruselige Zeug verdauen; beim Kino wird die gemütliche Erregung durch die rasche Folge der leibhaftig vor Augen geführten Bilder gehäuft und verstärkt; zum Nachdenken und Sich-befreien bleibt keine Zeit; es kommt nicht zum seelischen Ausgleich. Die schaurigen und grotesken "Dramen" erschüttern namentlich bei jugendlichen und empfindsamen Menschen das Nervensystem bis zur Qual, aber sie geben dem Zuschauer nicht die Mittel, mit denen er sich sonst der Angriffe auf sein Nervensystem erwehrt: er kommt nicht zur ruhigen Überlegung und geistigen Verarbeitung, zur nüchternen Kritik. Der unmöglichste Unsinn regt uns im Kino auf, wir werden gewissermassen vergewaltigt, betäubt durch die Hochflut des Schauerlichen, dessen psychologische Dürftigkeit wir erst hinterher allmählich ganz übersehen. Der erwachsene und kritische Zuschauer schüttelt dann ja wohl auch wie ein nasser Pudel das greuliche Zeug von sich ab; im Kinde und im urteilschwachen Menschen aber wirkt es weiter. Dazu kommt ja noch die bekannte psychologische Tatsache, dass nur wenige Menschen beim Hören oder Lesen aufregender Vorkommnisse so viel Phantasie haben, um sich das Geschilderte wirklich plastisch vor Augen zu stellen. Das Kino stellt aber alles gewissermassen leibhaftig vor Augen, und zwar unter den psychologisch günstigsten Bedingungen für eine tiefe und oft nachhaltige Suggestivwirkung: der verdunkelte Raum, das eintönige Geräusch, die Aufdringlichkeit der Schlag auf Schlag einander folgenden aufregenden Szenen schläfern in der empfänglichen Seele jede Kritik ein und so wird gar nicht selten der Inhalt des Dramas zur verhängnisvollen Suggestion für die willenlos hingegebene jugendliche Seele. Wir wissen, dass alle Suggestionen tiefer haften, wenn die Kritik schläft. Starke Gefühlserregung schläfert sie ein. Dass aber die Dramen des Kinematographen Gefühle und Leidenschaften der Kinder und der Ungebildeten in ihren Grundtiefen aufrütteln, dafür sorgt eine geschäftskundige Industrie mit schlauer Berechnung und grosser Findigkeit.
Unter den unterhaltenden Films sind die komischen vom ärztlichen Standpunkte aus ziemlich harmlos. Dass sie durch eine blödsinnige Situationskomik, durch eine übermässige Beschleunigung des Tempos der dargestellten Vorgänge den Wirklichkeitssinn der Jugend gefährden, hat Hellwig mit Recht an ihnen getadelt. Über ihre Geschmacklosigkeit habe ich hier nicht zu reden. Das gleiche gilt, und zwar noch mehr, von den Trickszenen, bei denen durch technische Künsteleien phantastisch-unwirkliche Vorkommnisse scheinbare Wirklichkeit gewinnen. Bei der Vorführung historischer und politischer Ereignisse werden grausige, die Nerven erschütternde Stoffe bevorzugt. So bekommt man die Schrecken der Bartholomäusnacht, die Folter der Inquisition, die Grausamkeiten der russischen Justiz, die furchtbaren Zerstörungen des Erdbebens von Messina zu sehen. Die dramatischen realistischen Films sind von zweierlei Art. Bei den einen handelt es sich um die kinematographische Reproduktion wirklicher Bühnenstücke, etwa eines Dramas von Shakespeare, der Räuber von Schiller. Der Erfolg dieser Vorführungen ist weit geringer als der von Dramen, die direkt für die Zwecke des Kinos "gedichtet" worden sind. Hier macht sich die widerliche und schädliche Spekulation auf die Freude der Menschen am Krassen und Schauerlichen, am Sentimentalen und sexuell Aufregenden besonders stark bemerkbar. Hier wird die Verfälschung des wirklichen Lebens mit allen Tücken schlauer Berechnung getrieben. Elend und Not, Armut und Krankheit, Verzweiflung und Selbstmord wandern in gewollter Verzerrung über die Bühnen und erwecken im Herzen des Kindes quälende Gedanken über die Ungerechtigkeit der Welt. Wir sehen, wie der Arme, wenn er stiehlt, mit rauher Hand in den Kerker geworfen wird, während der Reiche, wenn er dasselbe tut, rücksichtsvoll behandelt wird und alles mit Geld glatt erledigt. Wir Erwachsenen wissen, dass eine solche Darstellung bei uns in Deutschland blödsinnig ist, weil sie der Wahrheit ins Gesicht schlägt. Im Herzen des Kindes aber bleibt ein Stachel zurück; das Vertrauen auf Recht und staatliche Ordnung ist erschüttert. Die erotischen Films, deren schlimmste Nummern jetzt nicht mehr vorgeführt werden, weil die Polizei darüber wacht, wecken im Entwicklungsalter die Sinnlichkeit, verderben die Phantasie und damit auch die nervöse Gesundheit. Dramen wie "Die weisse Sklavin" oder "Die Vampirtänzerin
sind für das heranwachsende Geschlecht das reine Gift. Werden solche Nummern vorgeführt, so heisst es ja wohl auf dem Programm bisweilen: nur für Erwachsene; allein es werden trotzdem alle Kinder hereingelassen. Conradt erzählt, ein Unternehmer habe bei einem besonders unpassenden Stück verkünden lassen: "Diese Bilder dürfen nur Erwachsene sehen; wer noch nicht 18 Jahre alt ist, soll die Augen schliessen oder das Lokal verlassen." Ist es nicht eine Frechheit sondergleichen, auf solche Weise die Jugend planmässig zu verderben?
Für besonders gefährlich halte ich die Bilder aus dem Verbrecherleben, die auf alle Altersstufen nervenerregend und zerrüttend einwirken. Conradt fand auf 250 Films 97 Morde, 45 Selbstmorde, 51 Ehebrüche, 19 Verführungen, 22 Entführungen, 176 Diebstähle vorgeführt. Der oft technisch meisterhaften Darstellung blutrünstiger Geschichten kann sich auch der kritische Mensch nicht immer ganz entziehen. Der Zuschauer bemächtigt sich eine wachsende Aufregung, sie geraten in eine qualvolle Spannung mit Herzklopfen und Atembeschleunigung und verlassen oft mit tiefem Ekel das Theater. Alles, was ein Sherlock Holmes und Nick Carter in dicken Romanen an Schaurigem vollbringen, das müssen wir im Kino in 10 bis 15 Minuten in direkter Anschauung über uns ergehen lassen. Alle Formen des Selbstmordes lernen wir kennen. Kein Wunder, wenn schon gelegentlich, wie berichtet wird, ein überreizter Mensch, vom Kino heimkehrend, seinem Leben in der Weise ein Ende gemacht hat, wie das Drama im Kino es ihn lehrte.
Kein Wunder auch, wenn wir immer häufiger lesen, dass Kinder im Kino Aufregungszustände bekommen, die eine schwere Nervenschädigung verraten. Erst in diesen Tagen schrieb mir eine Stuttgarter Dame, dass eine ihrer Töchter beim Anblick des Bethlehemitischen Kindermordes eine schwere Nervenerschütterung mit heftigem Erbrechen erfuhr. Ähnliche Vorkommnisse sind viele berichtet worden. Die Vorführung grausamer Misshandlungen von Sklaven, der Auspeitschungen, Christenverfolgungen vermag ferner bei psychopathischen Naturen sexuelle Perversitäten zu fördern. Immer zahlreicher werden die Mitteilungen, dass eine kinematographische Darstellung eines Verbrechens einen halbwüchsigen Jungen zum Verbrechen verleitet hat. Am Tage, nachdem ich in Reutlingen über die Gefahren des Kinos für die Jugend gesprochen hatte, gingen mir von amtlicher Seite die Akten eines Falles zu, bei dem ein lasziv-erotischer Film einen halbwüchsigen Jungen zu Diebstählen weiblicher Wäsche verführt hat. Eine Auskleidungsszene im Kino hatte hier verhängnisvolle Ideen- [Ideenverbindungen] und Triebverbindungen geschaffen. Ein ganz grotesker Fall wird aus New York berichtet. Dort hatten drei italienische Knaben im Kino eine Szene gesehen, bei der ein Missionar von Kannibalen gebraten und verspeist wurde. Sie beschlossen, sich dasselbe Vergnügen zu machen. Ein kleiner Junge wurde niedergeschlagen, bewusstlos auf einen vorher präparierten Scheiterhaufen gelegt; die Brandwunden erweckten ihn wieder zum Leben; auf sein Jammern und Schreien eilten glücklicherweise einige Erwachsene herbei, die den Knaben vor dem Tode retten konnten; doch blieb er infolge der schweren Brandwunden ein Krüppel.
Mögen auch solche schauerlichen Vorkommnisse seltene Ausnahmen sein, so beweisen sie eben doch, dass die Wirkungen der Schundfilms namentlich auf jugendliche Personen ganz unberechenbar tief sein können. Wir Nervenärzte wissen, wie verhängnisvoll, ja geradezu entscheidend für die Nervengesundheit des jungen Menschen ein stark affektvolles Erlebnis werden kann. Kinder, Mädchen und Frauen kommen häufig zu uns mit ernsten und qualvollen nervösen Erkrankungen, die auf einen heftigen Schreck, auf ein angstvolles Erlebnis zurückgeführt werden müssen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Seelenverfassung des phantasieerregten Kindes, das im verdunkelten Raum des Kino in fieberhafter Erregung alle Schrecken des Dramas miterlebt, einer tiefen und nachhaltigen Schädigung besonders leicht zugänglich ist. Deshalb fort mit dem Schundfilm, fort mit den ordinären Verzerrungen des wirklichen Lebens, das ja schon genug Leid und Kummer mit sich bringt. Ehe nicht diese Scheusslichkeiten aus dem Kinematographentheater verschwunden sind, müssen wir mit allen Mitteln versuchen, wenigstens unsere Jugend von ihm fernzuhalten. Wir Ärzte können es nur mit Genugtuung begrüssen, dass unsere Schulvorstände das Verbot des Kinobesuches erlassen haben; aber wir müssen dahin wirken, dass alle diese Schauerstücke überhaupt aus dem Kino verschwinden. Allein man täusche sich über die Schwierigkeiten nicht
Denn es ist eine alte Erfahrung: Wer auf rohe Masseninstinkte spekuliert, ist noch immer auf seine Rechnung gekommen. Der Kino rentiert sich nur durch diese Schundfilms so gut, und unsere Bitten an die Filmfabrikanten und Kinobesitzer werden solange erfolglos sein, als diese Kinos nur in den Händen privater Unternehmer sind, die lieber viel als wenig Geld verdienen wollen. Auch von der Aufklärungsarbeit erwarte ich, so wichtig sie ist, doch keinen vollen Erfolg; denn die, die der Aufklärung am meisten bedürfen, hören uns nicht. Und so bleibt vom Standpunkt der öffentlichen Hygiene nichts anderes übrig, als zu verlangen, dass der Staat ein Gift beseitigt, das die Gesundheit unserer heranwachsenden Jugend untergräbt. Wir haben ja schon viele Seuchengesetze, warum nicht auch von Staats wegen eine Seuche bekämpfen, die mit erschreckender Verbreitungskraft unser Volk, vor allem unsere heranwachsende Jugend heimsucht? Nur von einem Reichs- [Reichsgesetz] oder Landesgesetz und nur von einer Reichszensur verspreche ich mir einen Gang der Dinge derart, dass die Fabrikation des Schundfilms nicht mehr lukrativ sein wird. Dann wird er sehr bald verschwinden. Und dann erst werden wir uns mit ganzem Herzen der schönen Erfindung des Kinematographen freuen können, der uns ermöglicht, was keine Zeit vor uns gekonnt hat: das Leben der Gegenwart in photographischer Treue und natürlicher Lebendigkeit festzuhalten und es der Nachwelt vor Augen zu führen, wenn unser Zeitalter längst seine Augen geschlossen hat.
===========
Der Kinematograph vom epischen und ästhetischen Standpunkt
Vortrag von Prof. Dr. Konrad Lange
Verehrte Anwesende
Der Herr Vorredner hat vom Standpunkt des erfahrenen Nervenarztes eine Kritik an dem gegenwärtigen Betriebe des Kinematographen geübt, mit welcher alle, die die Verhältnisse kennen, vollkommen einverstanden sein werden. Ich habe erst kürzlich, um mir ein Urteil über den hiesigen Kinematographen zu bilden, mehrere Vorstellungen desselben besucht und kann nur sagen, dass ich, abgesehen von dem psychischen Widerwillen, den ich bei den meisten Vorführungen zu überwinden hatte, die physischen Schädigungen der Augen und des Nervensystems besonders stark empfunden habe. Es mag ja sein, dass die benützten Films, die der Mehrzahl nach von bekannten Firmen in Paris, Turin usw. angefertigt sind, ursprünglich allen technischen Anforderungen entsprochen haben, jedenfalls ist aber die Art, wie sie hier - und wahrscheinlich auch in anderen kleineren Städten - abgespielt werden, technisch mehr oder weniger ungenügend. Das fortwährende Wackeln der Bilder - viele werden geradezu auf der Projektionsfläche am Auge vorbeigezogen -, ihre zeitweilige Dunkelheit und Unschärfe, das häufige Blitzen und Flimmern, alles das war für mich so lästig und anstrengend, dass ich noch tagelang nachher ein drückendes Gefühl um die Augen hatte. Ich zweifle nicht daran, dass wir durch den Kinematographen um ein neues Mittel zur Förderung der Kurzsichtigkeit und Nervosität reicher geworden sind. Bei der erschreckenden Zunahme dieser beiden Leiden in neuerer Zeit ist es geradezu unbegreiflich, dass auf diese Übelstände der neuen Erfindung so selten hingewiesen wird. Jedenfalls würde ich meinen Kindern schon aus diesem Grunde den Besuch des Kinematographen niemals erlauben.
Was nun die Schnelligkeit betrifft, mit der die Projektion erfolgt, so möchte ich den allgemein-psychischen Bedenken, die mein Kollege Gaupp dagegen geltend gemacht hat, noch einige ästhetische hinzufügen, die mir ebenfalls schwer genug zu wiegen scheinen. Das erste ist, dass die dargestellten Vorgänge dadurch einen unwahren und unnatürlichen Charakter annehmen. Wenn sich z. B. in einer Volksmenge die Personen übertrieben schnell bewegen, wenn in einer Landschaft das Wasser eines Wasserfalls doppelt so rasch als in Wirklichkeit fliesst, so kann ein ästhetischer Eindruck, vorausgesetzt, dass die Möglichkeit dafür überhaupt gegeben wäre, schlechterdings nicht zustande kommen. Das zweite ist, dass die Schnelligkeit des Ablaufs das Gegenteil von dem bewirkt, was jede künstlerische Darstellung bewirken möchte, nämlich Klarheit und Deutlichkeit der vorgeführten Gegenstände und Handlungen. Ist es doch ein wesentliches Verdienst der Kunst, speziell der Malerei, dass sie die in die Fläche zu übertragenden Naturvorgänge eben mit Rücksicht auf ihre Flächenhaftigkeit vereinfacht und verdeutlicht. Die kinematographische Darstellung einer bewegten Volksmenge aber gibt uns die Natur mit der ganzen Unruhe und Unklarheit wieder, die sie in der Wirklichkeit hat, und die, auf die Fläche übertragen, deshalb so stört, weil die Personen, die in der Wirklichkeit durch ihre Tiefendistanz voneinander geschieden werden, auf der Fläche rasch und unklar durcheinanderhuschen. Eine kinematographische Darstellung ist also schon aus rein formalen Gründen keine künstlerische Gestaltung der Natur, sondern eine ganz rohe Reproduktion derselben unter Steigerung ihrer Unruhe und Unklarheit.
In Bezug auf die kurze Position der Bilder und ihren raschen Wechsel ist zu sagen, dass auch dadurch der künstlerischen Wirkung geradezu entgegengearbeitet wird. Das unruhige Hasten und nervöse Sichüberstürzen, das in unserem modernen Leben leider nun einmal herrscht, wird dadurch auch auf die uninteressierte Anschauung übertragen. Bekanntlich besteht ein Hauptmangel unserer künstlerischen Bildung darin, dass die meisten Menschen völlig verlernt haben, sich intensiv in einen Naturvorgang oder ein Kunstwerk zu versenken, die Dinge ruhig und intim auf sich wirken zu lassen. Dieser Schwäche leistet der Kinematograph geradezu Vorschub. Wenn er uns Bilder zeigt, die trotz ihres ganz verschiedenartigen Inhalts in Eilzuggeschwindigkeit an unseren Augen vorüberfliegen, so dass wir, nachdem uns kaum ein Begräbnis irgendeiner Respektperson als solches deutlich geworden ist, plötzlich in den Salon eines Pariser Modegeschäfts versetzt werden, wo wir die Eleganz der neuesten Toiletten bewundern sollen, und wenn wir das eben fertig gebracht haben, plötzlich einem Pferderennen beiwohnen müssen, wobei die einzelnen Bilder immer ganz unmotiviert und plötzlich abbrechen, so ist das nicht nur der reine Stimmungsmord, sondern auch eine systematische Anleitung zu raschem und oberoberflächlichem [oberflächlichem] Sehen. In allen diesen Beziehungen ist der Kinematograph durchaus kunstfeindlich, arbeitet er der ästhetischen Bildung geradezu entgegen. Und wenn man fragt, warum das alles so sein muss, so lautet die Antwort, dass geschäftliche Internen dafür bestimmend sind: das Programm muss möglichst rasch heruntergespielt werden, damit das Theaterpublikum sich möglichst oft erneuern kann.
Noch schwerer aber sind die Anklagen, die der Ästhetiker und der Ethiker gegen den Inhalt vieler Films erheben müssen. Was ich Ihnen darüber zu sagen habe, ist durchaus nicht nur meine persönliche Meinung, ebensowenig wie Professor Gaupp mit seinen medizinischen Bedenken allein steht. Es ist vielmehr die Meinung aller unabhängigen und urteilsfähigen Männer, die sich in den letzten Jahren literarisch, sei es in Broschüren, sei es in Kino-Zeitschriften, Tageszeitungen und auf Kongressen, Lehrerversammlungen usw. über den Kino ausgesprochen haben. (Vergl. die Literaturangaben auf S.49 [Verweis &2]). Sie sind fast alle der Ansicht, dass die Gefahren des neuen Unterhaltungsmittels in ethischer und ästhetischer Beziehung ausserordentlich gross sind, dass diese schöne Erfindung, die ihrer Natur nach ein vortreffliches Volksbildungsmittel sein könnte, bei ihrem jetzigen Betriebe tatsächlich das grösste Unheil anrichtet, zur Verdummung und Verflachung, ja sogar zur ethischen und ästhetischen Verbildung unseres Volkes wesentlich beiträgt.
Das muss einmal öffentlich und mit Nachdruck gesagt werden. Und dazu ist eine Volksversammlung das beste, wenn nicht das einzige Mittel. Warum, das brauche ich hier wohl nicht näher auszuführen. Ich will mich deshalb mit der Mitteilung einer persönlichen Erfahrung begnügen. Vor etwa einem Jahre habe ich eine abfällige Kritik der jetzigen Kinoprogramme an eine Berliner Pressekorrespondenz gesandt, welche die Provinzblätter mit Feuilletons versieht, und von der ich gebeten worden war, ihr zuweilen einen Artikel zu schicken, dem ich weitere Verbreitung wünschte. Das Feuilleton wurde mir mit folgender Begründung zurückgeschickt: Obgleich man vollständig mit seinem Inhalt übereinstimme, sei man doch sehr beschämt, es nicht erwerben zu können, weil - die Zeitungen ihm aus realpolitischen Erwägungen heraus nicht die wünschenswerte Verbreitung geben würden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Es sind die hohen Inserateneinnahmen, welche die Zeitungsbesitzer von den Kino-Interessenten beziehen, und für die sie sich lieber durch günstige als durch ungünstige Kritiken revanchieren möchten. Sie sehen daraus, wie gross die Macht des Kapitals ist, gegen das wir ankämpfen müssen.
Seitdem sind die Verhältnisse allerdings besser geworden. Besonders die vornehmen Zeitungen der grösseren Städte haben sich mehr und mehr von der Gefährlichkeit des Kinematographen überzeugt und treten jetzt entschieden für eine Reform desselben ein. So dürfen wir denn hoffen, dass auch die Presse der kleineren Städte ihnen bald folgen werde. Gerade hierzulande wäre das deshalb besonders erwünscht, weil wir in Württemberg in der Präventivzensur und Kontrolle des Kinematographen bis jetzt noch erheblich hinter anderen Bundesstaaten zurückgeblieben sind.
Im allgemeinen kann man allerdings sagen, dass wir uns, was Tolerant in Sachen des Kinos betrifft, gegenseitig nicht allzuviel vorzuwerfen haben. Wenn die ärmeren und weniger gebildeten Kreise des Volkes den Verlockungen dieses neuen Unterhaltungsmittels in erster Linie zum Opfer fallen, so kann das nach dem, was Kollege Gaupp über die Natur dieser Vorstellungen gesagt hat, nicht wunder nehmen. Aber wenn auch Gebildete, selbst Angehörige der uns zunächst stehenden Kreise, die Mängel seines jetzigen Betriebes nicht zugeben wollen, so erklärt sich das, wie ich glaube, nur aus dem Mangel an tieferer ästhetischer Bildung, den wir - trotz aller Kunsterziehung - noch immer beklagen müssen. Kann man doch sehr häufig Stimmen hören, die den Kino mit Kunst in eine mehr oder weniger enge Verbindung bringen. Und gibt es doch hochgebildete Männer und Frauen, welche die Lichtspieltheater nicht nur selbst regelmässig besuchen, sondern auch ihren Kindern deren Besuch ohne Einschränkung gestatten, ja sie sogar selbst dazu ermuntern.
Am schlimmsten aber ist es, dass sogar Künstler und Kunstkritiker gar nichts Bedenkliches an diesen Vorführungen finden, im Gegenteil sie wegen der mannigfaltigen sinnlichen Anregung, die ihnen dadurch geboten wird, aufs dankbarste begrüssen. Wenn man ihnen dann vorhält, dass das, was sie da zu sehen bekämen, doch eigentlich keine Kunst, nicht einmal echte Natur sei, dass es vielmehr auf rohe Sensation hinauslaufe, dann geben sie das zwar - vielleicht - zu, haben aber auch gleich eine Ausrede bei der Hand: Sie wollten sich abends nach getaner Arbeit erholen, da möchten sie ihren Geist nicht mit schwerer Kost anstrengen. Man sei nicht immer in der Stimmung, Sophokleische Tragödien oder Wagnersche Musikdramen zu verdauen. Greife man doch auch vor dem Einschlafen nicht zu Shakespeare oder Goethe, sondern zu irgendeinem "amüsanten Schmöker", d. h. einem Indianerroman oder einer Detektivnovelle, wodurch man verstreut und nicht allzusehr in Anspruch genommen werde.
Ich weiss nicht, ob die, welche so sprechen, sich ihrer Verpflichtungen gegen die wahre Kunst völlig bewusst sind. Es trifft ja wohl zu, dass man nicht immer in der Stimmung ist, schwere geistige Arbeit zu tun. Besonders produktive Naturen leiden zuweilen an Abspannungszuständen, die ihnen abends die leichteste Kost am meisten willkommen machen. Aber es geht doch wohl nicht an, dass ein Gebildeter, noch dazu ein Künstler, nicht zwischen wahrer Kunst und Schund zu unterscheiden weiss. Er sollte schon des Beispiels halber das Schlechte nicht unterstützen und schon um seine eigenen Kunstbestrebungen nicht herabzusetzen, den Besuch minderwertiger Darbietungen unterlassen.
Meine Damen und Herren! Sie haben gerade jetzt in der Ausstellung gegen Schundliteratur Gelegenheit gehabt, die untergeordneten Erzeugnisse einer Bücherfabrikation kennen zu lernen, gegen die einsichtige und pflichttreue Männer schon seit Jahren einen energischen und erfolgreichen Kampf führen. Auch Sie werden entrüstet gewesen sein über die Kolportageromane, Nick Carter-Hefte und Sherlock Holmes-Geschichten, mit denen gewissenslose Verleger Millionen verdienen, indem sie aus der moralischen Irreführung und ästhetischen Verbildung des Volkes klingende Münze schlagen. Halten Sie es für logisch, sich dort über die Sensationsliteratur der Kriminal- [Kriminal-Novellen] und Detektiv-Novellen mit ihren blutrünstigen Illustrationen zu ereifern und gleichzeitig, womöglich in einem Atem damit, bildliche Vorführungen ganz ähnlichen Inhalts schön und gut zu finden? Denn tatsächlich handelt es sich bei den Kinovorführungen genau um dasselbe. Dem Schundroman in der Literatur entspricht der Schundfilm im Kinematographen. Und wenn ein Unterschied zwischen beiden besteht, so ist es lediglich der, dass der Schundfilm infolge seiner grösseren sinnlichen Anschaulichkeit und infolge der Billigkeit und Bequemlichkeit, mit der er dem Publikum dargeboten wird, weit unmittelbarer und stärker wirkt, also auch weit gefährlicher und verderblicher ist als der Schundroman. Auch darin stimmen beide überein, dass der Tadel nicht die Technik als solche, sondern nur die besondere Art ihrer Anwendung treffen kann. So wenig man der Buchdruckerkunst die Schundliteratur zum Vorwurf machen darf, ebensowenig darf man die wundervolle Erfindung des Kinematographen für jene Schundfilms verantwortlich machen, mit denen er sich heutzutage versündigt. Die Technik an sich ist gut und entwicklungsfähig, sie wird die äusserlichen Mängel, die ihr jetzt noch anhaften, im Laufe der Zeit immer mehr überwinden und sich uns immer unentbehrlicher machen. Aber sie soll sich in den Dienst der Kultur, nicht der Unkultur stellen.
Welches sind nun, so werden Sie fragen, diese Schundfilms, deren Ausmerzung wir im Namen der Kultur fordern müssen? Professor Gaupp hat sie Ihnen genannt: Es sind, allgemein gesprochen, alle Sensationsfilms, d. h. alle, die auf leere Sensation ausgehen, sei es nun, dass sie einer faden, geistlosen Komik huldigen, sei es, dass sie auf die Tränendrüsen der Halbgebildeten berechnet sind, sei es, dass sie es auf Nervenkitzel, Reizung der Sinnlichkeit, Erregung von Grauen, Schrecken, Furcht und Entsetzen abgesehen haben. Da kommen nun freilich die neunmal Weisen und sagen: Alles das ist nicht dem Kino allein eigentümlich. Man konnte es auch bisher schon, abgesehen von der Schundliteratur, in manchen unserer öffentlichen Schaustellungen finden, im Zirkus, in der Menagerie, auf Spezialitätenbühnen, ja sogar in gewissen Possen, Operetten und französischen Ehebruchskomödien. Das ist freilich wahr, und es liegt uns ganz fern, für die sensationellen Ausschreitungen dieser Jahrmarktskunst hier eine Lanze einzulegen. Aber der wesentliche Unterschied ist doch, dass dieser Inhalt auf den sensationellen Films in ganz besonders raffinierter Weise in die Erscheinung tritt, dass der Kino durch die Zusammendrängung auf einen kurzen Zeitraum, durch die unnatürliche Häufung ekelhafter und widerwärtiger Motive alle anderen Schaustellungen übertrifft, und dass er durch die Billigkeit und Bequemlichkeit seiner Vorstellungen das in ihnen konzentrierte Gift in die weitesten Kreise des Volkes trägt. Wir haben es also gewissermassen mit einer Quintessenz der Unkultur zu tun, deren Elemente aus verschiedenen unlauteren Quellen zusammengeflossen sind und hier in einer besonders gefährlichen Vereinigung auftreten und wieder in das Volk abgeleitet werden, gewissermassen mit kondensierter Roheit, gesteigertem Kitsch, raffinierter Indezenz in lieblichem Verein. Dabei ist noch besonders zu betonen, dass diese Schundfilms nicht etwa nur einen kleinen Teil des Programms bilden, so dass sie den überwiegend guten Nummern gegenüber allenfalls geduldet werden könnten, sondern dass sie, wie schon bemerkt, den Löwenanteil der Zeit für sich in Anspruch nehmen, also den Charakter der Vorstellungen wesentlich bestimmen. Die Konkurrenz der Filmfabrikanten untereinander, die sich schon zu zwei grossen Trusts vereinigt haben, die Rivalität der Filmverleihgeschäfte in den grösseren Städten, der Wettlauf der Kinotheater um die grösste Attraktion, die Geneigtheit, auf die ungesunden Masseninstinkte zu spekulieren, alles das hat zu einer so blödsinnigen Steigerung gerade dieser unerfreulichen Seite der Vorstellungen geführt, dass wir hier auf einem schlechterdings nicht zu überbietenden Höhepunkt angelangt sind. Und es muss zugegeben werden, dass der einzelne Kinobesitzer sich, so wie die Dinge jetzt liegen, dieser Bewegung nicht entziehen kann, wenn er konkurrenzfähig bleiben will. Es ist also nicht die Schuld des einzelnen, die hier zur Debatte steht, sondern die Schuld der Gesamtheit, gegen die wir Klage führen müssen. Wir müssen an den Verhältnissen als solchen Kritik üben. Und mindestens ebensosehr wie die Kino-Interessenten ist das Publikum zu tadeln, das mit seinem schlechten Geschmack gerade diese Films vor den übrigen bevorzugt. Allerdings führt jedes bessere Lichtspieltheater neben den Schundfilms, deren Dauer gewöhnlich mit Stolz auf eine Stunde und mehr angegeben wird, auch belehrende oder anständig-unterhaltende Films, Landschaften, Städtebilder, Reisen, Darstellungen fremder Völker und Länder, Tagesereignisse usw. vor. Allein diese sind schon durch die verhältnismässig kurze Zeit, die ihnen zugebilligt wird, als Nebensache charakterisiert und erregen auch infolge der lieblosen Art, wie man über sie hinweghudelt, kein besonderes Interesse. Man merkt ihnen nur zu deutlich an, dass sie lediglich Vorwand sind, dass sie den Anschein erwecken sollen, als ob das betreffende Lichtspieltheater auch belehrende oder sonstwie höhere Zwecke verfolge.
Der Begriff des Schundfilms kann natürlich weiter und enger gefasst werden. Ich verstehe darunter nicht nur die gemeinen und gefährlichen, sondern auch die dummen und albernen. Zu diesem rechne ich z. B. die meisten komischen oder grotesken Films. Sie sollen natürlich zum Lachen reizen, und dieser Zweck ist ja an sich nicht tadelnswert. Wer hörte nicht gern einmal einen Witz oder hätte nicht seine herzliche Freude an gesundem Humor? Aber was uns hier geboten wird, ist von wahrem Witz und gesundem Humor sehr verschieden. Es steht nicht einmal auf der Stufe der Clownspässe im Zirkus, höchstens auf der der Exzentriks, die allerlei körperliche Evolutionen mit übertriebenen Bewegungen und lächerlich gesteigerter Gesichtsmimik ausführen. Denn die Clowns sprechen doch wenigstens noch und machen zuweilen sogar ganz gute Witze. Das ist dem Kinematographen versagt, und damit ist ihm gerade der beste Teil der Komik verschlossen. Denn zum Witz gehört, wenn er gut sein soll, notwendig das Wort, und auch der wahre Humor ist ohne eine gewisse geistige Tiefe nicht zu denken. Der Kinematograph dagegen ist ganz auf die Wiedergabe von Bewegungen, d. h. auf die mimische Komik eingeschränkt. Laufen und Rennen, Hüpfen und Springen, Gliederverrenken und Hinpurzeln, Herumfuchteln mit den Händen und Gesichterschneiden, das sind die künstlerischen Mittel, mit denen er wirkt. Sein Witz wird deshalb immer auf der Oberfläche bleiben, seine Komik immer die flachste Situationskomik, sein Humor, wie man treffend gesagt hat, immer "Hampelmannhumor" sein.
Da wird z. B. geschildert, wie eine weisse Maus durchbrennt und wie ihre Besitzer, zwei Knaben, hinter ihr herrennen. Wie sich diesen dann die Dienstboten, mit Stöcken, Schirmen und Besen bewaffnet, anschliessen, wie zuletzt die ganze Hausbewohnerschaft dazu kommt und von der Leidenschaft der Verfolgung ergriffen wird. Durch Zimmer und Säle, über Treppen und Korridore, durch Küchen, Boden- [Bodenräume] und Kellerräume geht die wilde Jagd. Und wir sehen nun abwechselnd, in fabelhaft rascher Aufeinanderfolge, einerseits den Haufen der laufenden, rennenden, übereinanderpurzelnden, miteinander in Streit geratenden Menschen, andererseits die kleine weisse Maus, die ganz ruhig in einem Schrank oder im Ofen oder im Kamin, zuletzt sogar auf den Saiten des Pianofortes herumkrabbelt und gar nicht ahnt, was für eine Aufregung sie im Hause veranlasst hat. Also eine Darstellung, höchst primitiv nach ihrem Inhalt, flach und geistlos wie man es sich nur denken kann, aber dabei so raffiniert gemacht und zuweilen so originell ausgedacht, dass man sich immer wieder amüsiert, bis man zuletzt nach Ablauf der ganzen Handlung inne wird, dass man eigentlich lauter Unsinn gesehen hat.
Oder wir müssen erleben, wie ein Mensch von einem tollen Hunde gebissen wird, am Mittagstisch, wo er mit seiner Frau zusammensitzt, plötzlich selber toll wird, zu deren Entsetzen Hundegewohnheiten annimmt, auf allen Vieren herumkriecht, auf die Strasse springt, Menschen anbellt, Kälber in die Beine beisst, einen Metzgerladen plündert, die ganze Bewohnerschaft des Städtchens alarmiert, die nun lawinenartig anschwellend hinter ihm herhetzt und nach allerlei Zwischenfällen, bei denen er sich möglichst viehisch benimmt, schliesslich - man denke sich den Unsinn! - den Kranken durch einen Trunk frischen Wassers wieder zu sich bringt.
Das ist wirklich kein Humor mehr, das ist Roheit und Gemeinheit! Sind die besseren unter diesen Films für harmlose Gemüter ganz ergötzlich, für Gebildete freilich öde und langweilig, zum mindesten aber nicht gefährlich, so haben die schlechteren unter ihnen zuweilen etwas geradezu Ekelhaftes und Widerwärtiges, so dass sie auf Unmündige notwendig verrohend einwirken müssen. Kinder, die sich an solche Albernheiten gewöhnen, werden sehr bald den Sinn für wahre Komik und echten Humor verloren haben.
Eine besondere Nebengattung dieser Films sind die sogenannten
Trickfilms [Verweis &3], bei denen die Pointe darin besteht, dass man lebenden Menschen im entscheidenden Moment, wo die Sache gefährlich zu werden anfängt, Puppen oder Blechfiguren oder sonstige Surrogate unterschiebt, so dass die unmöglichsten und grässlichsten Dinge so glaubwürdig dargestellt werden können, als wären sie nach der Natur selbst aufgenommen. Diese Art Komik steht etwa auf der Höhe der bekannten studentischen Ulkphotographien, liesse sich übrigens ganz gut weiter ausbauen, wenn man nur darauf verzichten wollte, grausige und ekelhafte Motive mit ihr zu verbinden. Das gilt z. B. von der widerwärtigen Szene, wo ein Mann, der ganz in die Lektüre einer Zeitung vertieft ist, eine Allee entlang geht, von deren anderer Seite sich ihm eine grosse Dampfwalze nähert, die ihn endlich - man sieht das Unheil von Sekunde zu Sekunde näher kommen - ergreift und seinen Körper zu einem flachen Kuchen zusammenquetscht. Das ist ja schliesslich nicht viel schlimmer als die bekannten "Illusionen" der höheren Magie, die man schon früher vielfach sehen konnte: Menschen ohne Kopf oder ohne Beine, fliegende Personen und dergleichen mehr. Nur hat der Kinematograph die Mittel, solche Unmöglichkeiten ins geradezu Ungeheuerliche zu steigern. Und wenn das so dumm und sinnlos wie gewöhnlich geschieht, kann es nur üble psychische Folgen haben. Zwar die Ertötung des Wirklichkeitssinnes bei Kindern möchte ich ästhetisch nicht besonders schwer nehmen, denn Kinder leben ja in Märchenvorstellungen, und auch in der Kunst ist eine gewisse Phantastik berechtigt. Aber dann sollten diese Dinge auch geistreich und mit übersprudelndem Humor, vielleicht in satirischer Form vorgetragen werden, nicht in der lahmen, nüchternen und im Grunde langweiligen Form, wie es jetzt meistens der Fall ist. Aber wo hätten unsere Kinematographenkünstler jemals daran gedacht, die im Wesen des Kinos liegenden Möglichkeiten konsequent auszubauen und neue Kunstformen aus ihm zu entwickeln! Für die Ausbildung der Phantasie könnten diese Trickfilms sehr gut nutzbar gemacht werden. So wie sie jetzt gehalten sind, wirken sie als Irreleitung der künstlerischen Phantasie, die sich, wenn sie gesund bleiben soll, nur auf der Natur, auf klaren und deutlichen Naturvorstellungen aufbauen kann.
Zu den Schundfilms der dummen und albernen Art gehören auch die dramatischen Films. So möchte ich diejenigen nennen, die im Unterschied von den erotischen und Verbrecherfilms einen an sich anständigen Inhalt in dramatischer Form vorführen. Man bezeichnet sie auch wohl als "Kunstfilms", und die Filmfabrikanten tun sich nicht wenig auf sie zugute, weil sie bei der Aufnahme meistens von besseren Schauspielern gegen hohes Honorar (S. 2 [s. Verweis &1] gespielt worden sind und dadurch einige Ähnlichkeit mit Theateraufführungen bekommen haben. Sie sind es hauptsächlich, welche der Meinung Vorschub leisten, als handle es sich beim Kinematographen um Kunst. An ihnen muss also ganz besonders nachgewiesen werden, dass das ein Irrtum ist. Die meisten dieser "Dramen", wie man sie auch nennt, sind mehr oder weniger freie Übertragungen von Schau- [Schauspielen] oder Lustspielen in die kinematographische Technik, wobei natürlich die Worte weggelassen, hier und da wohl auch Kürzungen der Handlung vorgenommen worden sind. Es läge ja nahe, das Grammophon mit dem Kinematographen zu verbinden, und es hat auch nicht an Versuchen dieser Art gefehlt, aber diese sogenannten redenden oder singenden Photographien sollen - ich habe keine von ihnen gesehen - wegen der ungenügenden Wiedergabe der Worte so lächerlich gewirkt haben, dass man den Versuch bald wieder aufgegeben hat. Die Erfinder dieser dramatischen Films gehen nun von der Voraussetzung aus, dass das, was auf der Bühne mit Erfolg gespielt werden kann und wohl schon gespielt worden ist, auch im Kino Wirkung machen müsse. Das ist aber ganz irrig. Eine dramatische Handlung kann man, besonders wenn sie Anspruch auf geistige Bedeutung macht, ohne Hinzutritt des Wortes nicht verstehen. Ein grosser Teil ihrer ästhetischen Wirkung beruht geradezu auf der Schönheit des Dialogs und auf der Glaubwürdigkeit der psychologischen Entwicklung, die eben nur durch Worte veranschaulicht werden kann. Solange also der Kinematograph auf das Wort verzichten muss, ist er für die dramatische Darstellung - von der Pantomime sehe ich hier zunächst ab - ganz ungeeignet. Das wird jeder Freund der dramatischen Poesie zugeben. Da sitzen die Personen des Dramas ganze Szenen hindurch beieinander, gestikulieren lebhaft mit den Händen und bewegen ausdrucksvoll die Lippen. Wir haben die Überzeugung, dass sie sich über etwas sehr Richtiges unterhalten. Aber wir hören keine Worte, wir können also auch den Inhalt der Handlung nicht oder nur in den allergröbsten Umrissen verstehen. Und selbst über diese werden wir nur durch Überschriften, Erläuterungen, Briefe usw. aufgeklärt, die zwischen den Szenen, oft mitten in die Handlung hinein, projiziert werden. Abgesehen davon, dass diese "Schriftsätze" oft durch ihre Undeutlichkeit die Augen sehr anstrengen und uns ausserdem durch ihr schlechtes Deutsch ärgern, sollte schon dieses rohe und unkünstlerische Mittel jedem denkenden Menschen beweisen, dass wir es hier mit einer ganz unmöglichen Kunstgattung zu tun haben. In der Tat ist solch ein "Drama" meistens nichts als ein dürftiges Exzerpt aus einer vielleicht an sich ganz guten Dichtung, aus der man die Worte, d. h. den Geist, den tieferen Inhalt herausgezogen, und deren Wandlung man in eine Aufeinanderfolge äusserlicher Bewegungsvorgänge aufgelöst hat. So geschickt dabei auch manchmal die Bühnenbilder arrangiert sind, und so sehr sich die Schauspieler bemühen, durch ausdrucksvolle Bewegungen und lebhaftes Mienenspiel den Mangel des Wortes zu ersetzen, so peinlich ist doch in der Regel der Anblick einer Handlung, von der man sich bewusst ist, die eigentlichen Reinheiten doch nicht zu verstehen.
Man kann daraus den Bildungsgrad der Regisseure dieser Dramen oder der Filmfabrikanten abnehmen. Sie haben sich nicht einmal die Mühe genommen, die für den Kinematographen geeigneten Stücke auszuwählen, und sie sind zu faul und zu dumm gewesen, um die Originaldramen, die ihnen zur Verfügung standen, in Pantomimen zu übersetzen. Es ist ganz unbegreiflich, wie die Verfasser besserer Stücke sich eine solche Verballhornung ihres geistigen Eigentums gefallen lassen können, noch unbegreiflicher, wie bedeutende Schauspieler sich zu einer solchen Verballhornung hergeben mögen. Aber freilich -
Erträglicher sind die Dramen, die von vornherein als Pantomimen gedacht und als solche auch durchgeführt sind. Dass die Schauspieler dabei in Gesten und Gesichtsausdruck übertreiben, ist an sich nicht tadelnswert, da jede Kunst das, was sie erreichen will, nur durch Steigerung und Akzentuierung erreichen kann. Schlimmer ist schon, dass der Inhalt der anständigen Pantomimen aus naheliegenden Gründen in der Regel fade und unbedeutend ist. Da sie meistens aus Paris stammen, entsprechen sie ungefähr dem bürgerlichen Durchschnittsgeschmack der halbgebildeten Franzosen. Besonders charakteristisch ist für diesen offenbar die Freude an sentimentalen Szenen, an rührselig-melodramatischen Aktschlüssen. Ich erinnere mich noch mit Widerwillen des alten Geigers, der sich in eine jugendliche Schülerin verliebt und, wie er ihr gerade einen Antrag machen will, durch ein riesiges Bukett, das hereingebracht wird, zu der Erkenntnis kommt, dass sie schon verlobt ist. Wehmütig resigniert er und lässt sich sogar bestimmen, bei der Trauung seiner Angebeteten auf der Empore der Kirche zu ihrer Ehre ein Stück auf der Geige zu spielen. Noch klingt mir das Klaviergepauke in den Ohren, das ein gottverlassener "Musiker" während und anstatt dieses Violinspiels aus seinem verstimmten Klimperkasten vollführte. So faul und gleichgültig sind diese Kinobesitzer, dass sie zum Geigenspiel des Bildes nicht einmal die Geige spielen lassen.
Ganz schlimm aber ist es, wenn man diesen Dramen dadurch einen höheren Wert zu verleihen sucht, dass man klassische Dichtungen in solch barbarischer Weise herrichtet. Man denke sich etwa Shakespeares "Julius Caesar" oder Schillers "Wilhelm Tell" auf ein Drittel des Umfangs zusammengedrängt, der Worte beraubt und als einfache Folge von Bewegungsvorgängen an die Wand geworfen! Da quälen sich unsere Lehrer in der Literaturstunde ab, ihren Schülern den Tyrannenmord mit Hilfe der Worte begreiflich zu machen, seine Notwendigkeit aus dem logischen Verlauf der Handlung zu beweisen, und wenn ihnen das glücklich gelungen ist, dann kommt dieser Kinematograph und reisst das ganze mühsam aufgerichtete Gebäude wieder zusammen, indem er den Kindern das Schreckliche als rein äusserlichen Bewegungsvorgang, als einfachen brutalen Totschlag vor Augen führt! Wir müssen gegen eine solche Verhunzung der klassischen Dichtungen protestieren; denn ihre Folge ist eine systematische Verdummung unserer Jugend, eine gewaltsame Vernichtung der Fähigkeit, wahre poetische Schönheit zu empfinden. Man könnte diese dramatischen Films deshalb auch (ebenso wie die meisten grotesken) als Verdummungs- [Verdummungsfilms] oder Verblödungsfilms bezeichnen.
Gefährlicher als diese Dramen, die schliesslich nur ästhetischen Widerwillen erregen können, sind die seriellen oder pikanten Films, die natürlich ebenfalls dramatische Form haben. Sie sind fast durchweg französischen Ursprungs, gehören also, wie die bekannten erotischen Romane und Ehebruchskomödien, die unseren Büchermarkt und unsere Bühnen überschwemmen, zu den schönen Errungenschaften, die wir unseren westlichen Nachbarn verdanken. In Amerika, wo in dieser Beziehung noch ein gewisser puritanischer Geist herrscht, auch in Schweden und Dänemark sind sie verboten. In Deutschland üben besonders Sachsen und Bayern ihnen gegenüber eine scharfe Zensur, Bayern wohl infolge der Empfindlichkeit der Zentrumspartei gegen allen Schmutz in Wort und Bild.
Man kann nun vielfach lesen, die gröbsten Auswüchse dieser erotischen Films seien in den letzten Jahren infolge der Zensur, die freilich sehr verschieden gehandhabt werde, unterdrückt worden. Dem gegenüber muss aber betont werden, dass das wohl hier und da antreffen mag, im allgemeinen aber durchaus nicht der Fall ist. Wenigstens konnte noch vor zwei Jahren der Pfarrer Conradt schreiben: "Dass an zensurfreien Orten und auf dem Lande viele schmutzige Dinge öffentlich gezeigt werden, beweisen die von preussischen Staatsanwälten konfiszierten Films, für die im Laufe der Zeit das Berliner Polizeipräsidium die Sammelstelle werden soll. Was aber an gemeinen Films tatsächlich existiert und auch vorgeführt wird (z. B. in Herrenkabaretts oder auf dem Lande), davon hat keine Behörde eine Ahnung. Diese bis ins kleinste Detail ausgeführten Schmutzereien und widernatürlichen Scheusslichkeiten spotten jeder Beschreibung, sie lassen sich nicht einmal andeuten." Das gilt allerdings nur für die Länder, in denen keine Zensur besteht. Dass es in Ländern mit Zensur bedeutend besser ist, dürfte genügen, um die Nützlichkeit der Zensur zu beweisen. Jedenfalls scheint aber bei den Filmfabriken die Anfertigung solcher Films noch in vollem Schwange zu sein. In Berlin wenigstens hat der Prozentsatz der konfiszierten Films neuerdings nicht nur nicht abgenommen, sondern sogar zugenommen. Charakteristisch ist auch, dass erotische Szenen sich immer mehr in sonst anständige Films eindrängen. Man scheint zu glauben, dass nur an den Haaren herbeigezogene Anzüglichkeiten einer Handlung die richtige Würze, den richtigen Pfeffer zu geben vermögen.
Besonders häufig ist die Verbindung des Sexuellen mit dem Kriminellen. Hängen doch die erotischen und die grausamen Instinkte des Menschen eng miteinander zusammen. Ein beliebtes Thema ist der Mädchenhandel, wobei die Versicherung, durch solche Films aufklärend oder abschreckend wirken zu wollen, natürlich Vorwand ist. "Edith, die weisse Sklavin", das ist ein Film, der ja auch hier mit grossem Erfolg gegeben worden ist. Das Leben in einem Freudenhause jenseits des Ozeans, in das ein anständiges Mädchen infolge ihrer Unvorsichtigkeit geraten ist, ein Verführungsversuch, der an ihr gemacht wird, aber mit der Strangulierung des Verführers durch die zarten Hände der Heldin endigt, eine Orgie im Freudenhause, bei der die "Herren" betrunken sind, die "Damen" Cancan tanzen und sich im Bauchtanz üben, eine Flucht aus dem Fenster an zusammengeknüpften Bettlaken, eine aufregende Verfolgung der Flüchtlinge im Automobil, Handgemenge, Zurückführung in die Gefangenschaft und schliessliche Rettung, das sind so die Hauptszenen dieser "spannenden
Geschichte. Zwischenhinein werden dann schöne Seebilder vorgeführt, die das Ganze auf ein ästhetisches Niveau emporheben sollen, und zuletzt fehlt natürlich nicht der versöhnliche Schluss, wobei sich alles in eitel Glück und Wohlgefallen auflöst. Denn die Erfinder dieser Films sind anständige und gebildete Leute. Sie wissen aus der Ästhetik, dass in jedem Drama die Tugend belohnt und das Laster bestraft werden muss. Ende gut, alles gut. Es lebe die poetische Gerechtigkeit.
Wie derartige Vorführungen von gebildeten Damen aufgefasst werden, mag Ihnen ein Eingesandt aus einer Stuttgarter Zeitung vom 10. Februar dieses Jahres zeigen, das unterschrieben ist: "Eine Tübinger Abonnentin". Es heisst da mit Beziehung auf diesen oder einen ähnlichen Film: "Die Vorstellung, die den Titel trug: 'Eine von vielen' lockte meinen Mann und mich durch die Anpreisung, [']wundervolle Seebilder'. Die Seebilder waren in der Tat gut, dann aber steigerte sich die Handlung zu Szenen, wie sie ekelhafter kaum ausgedacht werden könnten. Für mich waren es Darstellungen von Zuständen, deren Existenz mir zwar bekannt, aber in ihrer ganzen schmutzigen Grässlichkeit noch nie so zum Bewusstsein gekommen war. Ich war ausser mir, und meine Erregung wurde so gross, dass mein Mann mich in meiner darauf folgenden Übermüdung kaum nach Hause brachte. Die Bilder verfolgten und quälten mich noch zwei Tage. Ausser uns waren viele Studenten, junge Mädchen und Arbeiter Zuschauer gewesen. Welchen Eindruck mag auf sie jene Vorführung gemacht haben? Wenn meine Empörung dieser Sache gegenüber auch nichts ausrichtet, so möchte ich doch dabei sein, wenn Stimmen gesammelt werden für den Wahlspruch: 'Weg mit dem Kinematographen'.
Sie werden vielleicht fragen, wie es möglich war, dass ein solcher Film von der hiesigen Polizei zugelassen werden konnte. Das erklärt sich aber sehr einfach. Da wir kein Reichsgesetz über den Kinematographen haben und bis jetzt auch kein Landesgesetz in Württemberg besteht, bleibt die Zensur und Kontrolle den Polizeibehörden überlassen, die durch eine ministerielle Verordnung vom 17. November 1908, die später noch einmal wiederholt wurde, nur im allgemeinen angewiesen sind, die Kinotheater streng zu beaufsichtigen. Um nun einen bestimmten Massstab zu haben und wenigstens eine gewisse Gleichmässigkeit der Beurteilung zu erreichen, legen die Polizeiverwaltungen mancher Städte, so auch die unsrige, bei ihren Entscheidungen die von der Berliner Polizeibehörde vorgenommene Zensur zugrunde. Das heisst sie lassen nur diejenigen Films zu, für die der Erlaubnisschein der Berliner Zensurbehörde beigebracht werden kann. Die Berliner Zensur aber liegt nach Conradt "in den Händen von Männern, die mit der langen Erfahrung ihres Zensoramtes ein feines Verständnis für sittliche und religiöse Werte verbinden und die - soweit es an ihnen liegt - nicht zugeben werden, dass ein berechtigtes Empfinden verletzt wird". Trotzdem hatte diese Berliner Zensurbehörde den erwähnten Film nicht beanstandet, und folglich lag auch für unsere Polizeibehörde kein Grund vor, ihn zu verbieten. Denn man geht hier von der gewiss richtigen Anschauung aus, dass es ganz unmöglich ist, jede Polizeibehörde selbständig über die Zulassung eines Films entscheiden zu lassen. Was würde ihr auch eine Zurückweisung nützen, wenn derselbe Film in Berlin, in Stuttgart und in zahlreichen anderen Städten zugelassen ist und fortwährend vorgeführt wird? Sie würde sich nur den grössten Unannehmlichkeiten von seiten des Kinobesitzers aussetzen und einen Prozess nach dem anderen zu führen haben. Denn die Kinobesitzer sind gut organisiert. Sie haben z. B. hier in Württemberg einen eigenen Rechtsanwalt - es sollte mich wundern, wenn der Herr nicht heute hier anwesend wäre -, dessen Pflicht es ist, gegen jede Beeinträchtigung des von ihm vertretenen Gewerbes bei den Gerichten einschreiten oder bei dem zuständigen Ministerium vorstellig zu werden. Die erwähnte Aufführung ist eben einer der Fälle, die zeigen können, dass der jetzige Zustand unhaltbar ist, dass selbst die Berliner Zensur nicht genügt, und dass diese anstössigen Films einfach durch Reichsgesetz verboten werden müssen.
Dass aber die Polizei es nicht gern auf einen Prozess ankommen lässt, erklärt sich einfach aus der Unbrauchbarkeit unseres Gesetzes gegen die Verbreitung unzüchtiger Schriften und Abbildungen. Wenn es nämlich da (im § 184) heisst, dass nur diejenigen Bilder und Schriften strafbar sind, die "das Schamgefühl gröblich verletzen", so zeigt schon diese Fassung, dass wir es mit einem richtigen Kautschukparagraphen zu tun haben. Was heisst denn "das Schamgefühl gröblich verletzen"? Das Wörtchen "gröblich" hat der Gesetzgeber offenbar in den Paragraphen hineingebracht, um den Volksverderbern einen liebevollen Wink zu geben, dass die blosse Verletzung des Schamgefühls, solange sie noch nicht "gröblich" ist, straflos bleiben soll. Den Punkt aber, wo sie anfängt gröblich zu werden, hat noch niemand genauer bestimmt. Das Schamgefühl der Tübinger Dame, von der das vorgelesene Eingesandt stammt, ist offenbar durch die betreffende Vorführung gröblich verletzt worden. Es fragt sich aber sehr, ob derselbe Film z. B. auch das Schamgefühl eines Schutzmanns, der zur Kontrolle angestellt worden wäre, gröblich verletzt haben würde. Wessen Schamgefühl soll nun massgebend sein? Die hier anwesenden Herren Juristen werden vielleicht sagen: "Das des Durchschnittsmenschen, des Normalmenschen." Leider ist mir aber ein solcher bisher im Leben noch nicht vorgekommen, ich weiss deshalb auch nicht, was sein Schamgefühl aushalten kann. In der Praxis helfen sich die Gerichte ja meistens damit, dass sie Sachverständige zuziehen, deren Gutachten zuweilen berücksichtigt wird. Aber gerade diese Sachverständigen sind doch gewöhnlich keine Durchschnittsmenschen und stimmen auch meistens nicht miteinander überein. Ich bin wiederholt bei solchen Prozessen zugezogen worden und habe dabei die Beobachtung gemacht, dass in Deutschland zwei Sachverständige immer drei verschiedene Meinungen haben, abgesehen davon, dass es auch unter ihnen - "Schwachverständige" gibt. Jedenfalls dürfte es im Zweifelsfall richtiger sein, sich an das Urteil der Feinfühligen und Empfindlichen, als an das der Grobknochigen und Dickfelligen zu halten. Der Hauptfehler aber, den man bisher bei solchen Prozessen immer gemacht hat, ist, dass nicht scharf genug zwischen Kunst und Nichtkunst unterschieden worden ist. Es muss von vornherein festgehalten werden, dass der Kinematograph keine Kunst, sondern Wirklichkeit, photographierte Wirklichkeit ist. Wenn jemand auf offenem Markte Photographien unanständiger Frauenzimmer in zweideutigen Situationen verkauft oder zeigt, so ist das, da es sich ja um Naturaufnahmen handelt, beinah dasselbe, wie wenn diese Personen in Wirklichkeit auftreten und ihre Schamlosigkeiten vor versammeltem Volk zum besten geben würden. Ebensogut wie das letztere strafbar wäre, müsste auch das erstere strafbar sein. Genau so verhält es sich aber mit dem Kinematographen. Es ist ein schwerer Fehler, den man ihm gegenüber immer begeht, dass man ihn für Kunst hält, vom Standpunkt der Kunst beurteilt. Das muss notwendig zu einer Milde führen, die den Tatsachen durchaus nicht entspricht. Die Kunst nämlich steht dem seriellen Stoffgebiet in ganz besonderer Weise gegenüber. Sie hat von jeher das sexuelle Leben, sittliche Verfehlungen, Laster aller Art zum Gegenstande ihrer Darstellungen gemacht. Und zwar mit vollem Recht. Denn einerseits hat sie die Pflicht, das Leben so zu schildern wie es ist, anderseits stehen ihr die Mittel zu Gebote, das Widerwärtige und Abstossende durch die Form, in die sie es kleidet, durch die künstlerische Gestaltung in ein höheres Niveau zu heben. Wenn Goethe in seinen "Wahlverwandtschaften" bedenkliche Verhältnisse schildert, so tut er das mit der überlegenen Kunst des grossen Dichters, der die Handlungen seiner Personen psychologisch motiviert, das Herannahen der Sünde und das damit zusammenhängende Hereinbrechen des Unglücks als glaubwürdig, ja sogar als notwendig erscheinen lässt. Der Kinematograph dagegen ist dazu, wie wir schon gesehen haben, ausserstande. Er stellt die unsittlichen Handlungen ohne jede Begründung, ohne psychologische Motivierung als einfache Bewegungsvorgänge dar, so dass sie nicht wie Kunst, sondern wie Natur wirken. Allerdings sind diese Szenen nach schauspielerischen Darstellungen aufgenommen, wodurch sie einen gewissen künstlerischen Charakter erhalten können. Trotzdem wirken sie in der mangelhaften Begründung, in der sie hier erscheinen, nicht wie Kunst, sondern wie Natur, d. h. wie Natur-Photographien. Gerade daraus ergeben sich aber gewisse Gefahren für jugendliche und unreife Personen, die man unmöglich übersehen kann. Während die Kunst im allgemeinen, eben wegen ihrer besonderen Eigenart, nicht demoralisierend wirkt, beeinflusst diese Wirklichkeitsdarstellung, besonders wenn ihr Inhalt ohne Motivierung, als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches vorgeführt wird, das Wollen und den Charakter jugendlicher Personen unter Umständen in sehr starker Weise. Wie leicht kann da in den jugendlichen Köpfen, in denen die Kritik nur wenig entwickelt ist, die Vorstellung entstehen, als ob unsittliche Handlungen, Verführungsszenen, Feindschaft zwischen Eheleuten, gegenseitiges Anlügen, Betrug, Scheidung und Ehebruch in den Familien der Gebildeten nur so an der Tagesordnung wären, als ob man darin gar nichts Bemerkenswertes sähe, es gar nicht besonders missbilligte. Das hat aber nicht nur eine gewisse Trübung und Verfälschung des Wirklichkeitssinnes zur Folge, sondern muss auch in sozialer Beziehung verhetzend auf die ärmeren Volksklassen einwirken. Vor allen Dingen aber wird die Jugend dadurch in sexueller Beziehung ungünstig beeinflusst. Conradt führt den Fall an, dass ein Bursche schon durch die Anschauung von Balletts und Tänzen im Kino dazu gebracht wurde, seine Braut zu verlassen und auszuziehen, um eine Tänzerin zu heiraten. Notorisch ist auch, dass die Jugend durch sexuelle Films ganz im allgemeinen das Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse verliert und dadurch der Verführung zugänglich gemacht wird. So ist z. B., wie Hellwig ausführt, durch Prozesse nachgewiesen worden, dass halbwüchsige Mädchen durch die unsittliche Einwirkung des Kinematographen dem Verführer in die Arme getrieben worden sind.
Bei der Kontrolle der sexuellen Films durch niedere Polizeiorgane wird immer die Gefahr bestehen, dass zwar die allerdeutlichsten Darstellungen kassiert werden, das versteckt Sexuelle dagegen, das bekanntlich am meisten reizt, unbeanstandet bleibt. So ist es z. B. ein bekannter Trick, dass unanständige Entkleidungsszenen nur bis zu einem gewissen Punkte geführt werden, vor Eintritt der völligen Nacktheit dagegen abbrechen. Es lässt sich nachweisen, dass ungebildete Zensoren in solchen Fällen die Anstössigkeit nicht empfinden, während sie ja eigentlich grösser ist als bei der vollen Nacktheit. So wenig ich ein Freund der sogenannten Nackttänze bin, muss ich doch sagen, dass diese, soweit sie Kunst sind, besonders im Kinematographen noch immer berechtigter wären als die verschleiert sexuellen Darstellungen, die die Phantasie besonders der Jugend in ungesunder Weise reizen.
Kurz und gut, wir müssen ein gesetzliches Verbot nicht nur der sexuellen, sondern auch der pikanten Films fordern, und zwar mit besonderer Betonung des Umstandes, dass sie niemals wirkliche Kunst sind. Wir haben nicht das geringste Interesse daran, diese Pseudokunst oder besser gesagt Unkunst gegen die Strenge des Strafrichters zu schützen. Es liegt vielmehr im Interesse der wahren Kunst, wenn jene als das charakterisiert wird, was sie ist, nämlich photographierte Wirklichkeit, die das Schamgefühl gröblich verlebt.
Ebenso gefährlich wie die sexuellen Films sind die Mord- [Mordfilms] oder Verbrecherfilms, die jetzt wohl in allen Kinovorstellungen den grössten Raum in Anspruch nehmen. Wir fassen unter diesem Namen alle dramatischen oder pantomimischen Darstellungen zusammen, deren Inhalt Mord und Totschlag, Gift und Dolch, Attentate und Hinrichtungen, Raubanfälle und Einbrüche, Selbstmorde und Torturen, Schmuggel und Diebstahl, Trunksucht, Tierquälerei, Feuersbrunst, Eisenbahnunfälle, Explosionen, Schiffszusammenstösse und dergleichen schöne Dinge sind. Es ist geradezu unglaublich, wie erfindungsreich die Phantasie der Kinofabrikanten und ihrer künstlerischen Helfer in dieser Beziehung ist. E. T. A. Hoffmann, Edgar Poe und Connon Doyle sind Waisenknaben gegen sie. Und die raffinierte Technik des Kinematographen macht die Darstellung der unglaublichsten, gefährlichsten und waghalsigsten Dinge möglich, zumal da die Fabriken kein Opfer scheuen, um eine solche Aufnahme möglich lebenswahr zu gestalten. Automobile, die einen Abhang hinunterstürzen und dabei explodieren, werden ganz einfach geopfert, nur um den "Knalleffekt" so eines Films in voller Naturwahrheit zur Anschauung bringen zu können. Dabei ist der Inhalt dieser Films auf den schlimmsten und gefährlichsten Instinkten der menschlichen Natur aufgebaut. "Streitlust, Habgier, Furcht, Hass, Rachsucht, Mordlust, Eifersucht verbinden sich," so sagt Conradt, "um die Menschen wie wilde Tiere aufeinander zu hetzen. Gift, Strick, Dolch, Messer, Revolver, Büchse spielen ihre traurige Rolle." Professor Gaupp hat Ihnen schon mitgeteilt, dass Conradt in 250 Stücken dieser Art, die er in Berlin gesehen, nicht weniger als 97 Morde, 51 Ehebrüche, 19 Verführungen, 22 Entführungen, 45 Selbstmorde gezählt hat, dass unter den auftretenden Personen 176 Diebe, 25 Dirnen, 35 Trunkenbolde und ein Heer von Schutzleuten, Detektivs und Gerichtsvollziehern zu zählen waren. Es ist geradezu eine Zusammenhäufung alles Scheusslichen und Widerwärtigen, was es im Leben gibt, wiederum ohne künstlerische Gestaltung, ohne ästhetische Abstraktion dargeboten.
Die grosse Beliebtheit, deren sich diese Stoffe erfreuen, erklärt sich aus einer bekannten Eigentümlichkeit der menschlichen Natur. Der Mensch, auch der gebildete, hat ein bestimmtes Bedürfnis, sich aufzuregen. Er möchte Abenteuer erleben, zum mindesten mit ansehen, die dramatischen Seiten des Daseins kennen lernen. Da der moderne Staat die Möglichkeiten hierfür glücklicherweise eingeschränkt hat, ist es begreiflich, dass wir uns wenigstens künstlich Anschauungen dieser Art zu verschaffen suchen. Das gegebene Mittel dafür ist die Kunst. Sie ist dazu da, dieses Bedürfnis in anständiger und vornehmer Weise zu befriedigen. Darauf beruht es, dass das Verbrechen in der Kunst, besonders in der dramatischen von jeher eine grosse Rolle gespielt hat. Aber auch hier müssen wir den grossen Unterschied zwischen dem Kinematographen und der wirklichen Kunst hervorheben. Es ist etwas wesentlich anderes, ob das Verbrechen von Shakespeare in seinem Richard III. und von Lessing in seiner Emilia Galotti geschildert, d. h. mit strenger psychologischer Begründung, mit dem Reiz der künstlerischen Illusion vorgeführt wird, oder ob es uns im Kinematographen in der Form der Naturphotographie vor Augen tritt. Im ersteren Falle erleben wir eine ästhetische Erhebung, eine Gemütsbefreiuung [Gemütsbefreiung], im letzteren werden wir in die gemeine Welt des Verbrechens herabgezogen.
Nur ein paar Beispiele dieser Gattung seien angeführt. Da konnte man z. B. vor einigen Tagen hier in Tübingen den schönen Film "Der fliegende Zirkus" sehen. Wäre er doch nur in der Luft herumgeflogen, das hätte wenigstens ein dem Kinematographen angemessener drolliger Effekt sein können. Aber nein, es war eine ganz banale Seiltänzerliebschaft mit Einfügung gruseliger Motive. Um die Hand der von ihm geliebten Bürgermeisterstochter, die ihm im Zirkus eine Rose zugeworfen hat (!), zu erringen, wagt der Seiltänzer den schwindelnden Weg über das Seil, das vom Marktplatz zum Kirchturm emporgespannt ist. Der Vater, der nichts von einem Artisten als Schwiegersohn wissen will, hat ihm die Hand der Tochter als Lohn für dieses Kunststück versprochen (!). Aber das Unheil naht. Die Riesenschlange (in der Tat ein sehr schönes Tier und ein gutes Sujet für den Kinematographen) hat ihre Kiste heimlicherweise verlassen. Hätte noch die eifersüchtige Schlangenbändigerin die bewusste Veranlassung dazu gegeben, um sich an dem ungetreuen Bräutigam zu rächen, so hätte die Sache wenigstens einen gewissen dramatischen Sinn gehabt. Aber nein, die Schlange gewinnt infolge einer blossen Unvorsichtigkeit das Freie! Sie verlässt den Kunstreiterwagen und kriecht über den Marktplatz herüber zum Kirchturm, ersteigt dessen Treppe und ringelt sich gerade an der Stelle um das aufgespannte Seil, wo dieses an einem Fenster des Turmes befestigt ist. Der Seiltänzer schreitet bis zu dieser Stelle empor, und wie er eben in den Turm einsteigen will, da bemerkt er - o Graus! - das Ungeheuer, das ihm den Weg versperrt. Zwischendurch sieht man immer die aufgeregte beifallklatschende Menge unten auf dem Marktplatz stehen, darunter auch die Bürgermeisterstochter und ihren Vater. Sie erkennt die Lebensgefahr, eilt dem Geliebten zu Hilfe die Treppen des Turmes empor, sucht die Schlange am Schwanze wegzuziehen, was ihr natürlich nicht gelingt. Der Mann scheint verloren. Da stürzt sie die Treppen wieder herab zu der Schlangenbändigerin, ihrer Rivalin. Demütige Erniedrigung, innerer Kampf, Grossmutsszene, Tableau. Die Schlangenbändigerin beschliesst zu Hilfe zu kommen. Es gelingt ihr das Tier zu überwältigen, der Vater ist gerührt, alles sinkt sich mit Tränen der Freude in die Arme, die Verlobung wird gefeiert. Die Schlangenbändigerin aber wirft, hinter dem fortfahrenden Zirkus hergehend, noch einmal einen vielsagenden sauersüssen Blick auf das glückliche Brautpaar zurück. Natürlich, das Ganze muss ja gut ausgehen, sonst wäre es anstössig! Also eine durch und durch verlogene Geschichte, ein unwahres, lügenhaftes, völlig unkünstlerisches Gemisch furchtbarer und alberner Motive. Ein grausiger Inhalt, aber die Konsequenzen daraus nicht gezogen, allem, was einer künstlerischen Ausgestaltung fähig gewesen wäre, im entscheidenden Moment die Spitze abgebrochen! Ein solcher Film wird freilich niemand zum Verbrecher machen. Aber er wird das gesunde Empfinden der Jugend unfehlbar verderben, den Sinn für das künstlerisch Mögliche, für ästhetische Qualität bei den Erwachsenen mit Sicherheit untergraben.
Ein anderes Beispiel. Zwei Verbrecher verstellen eine Weiche, um den fälligen Schnellzug zum Entgleisen zu bringen und die Reisenden in der bevorstehenden Verwirrung zu berauben. Aber die Tochter des Weichenwärters bemerkt die Gefahr, sie will den Zugführer warnen, indem sie dem Zuge entgegenläuft. Aber sie wird von den beiden Unholden ergriffen und auf die Schienen gebunden, einem sicheren Tode geweiht. Der Schnellzug braust heran, er kommt immer näher, im nächsten Augenblick wird das Unglück geschehen sein. Da - die Aufregung des Publikums ist auf den höchsten Gipfel gestiegen, die Backen glühen und die Augen treten aus ihren Höhlen - kommt ihr der Vater oder der Geliebte zu Hilfe, reisst sie von den Schienen weg, stellt die Weiche wieder richtig und - das Furchtbare ist abgewendet.
Am schlimmsten aber ist wohl folgender Film, der noch vor kurzem in Stuttgart gespielt wurde: Eine vornehme Dame besitzt zwei Löwen, ein Männchen und ein Weibchen (merkwürdige Liebhaberei!). Der Wärter, der von seiner Herrin wegen irgendeiner Nachlässigkeit getadelt worden ist, rächt sich an den Löwen, indem er sie durch Stossen mit einer eisernen Stange quält. Man sieht, wie die schönen Tiere in Wut geraten, wie sie die Zähne fletschen und mit den gewaltigen Pranken an den Eisenstäben ihres Käfigs rütteln. Die Herrin kommt darauf zu und versetzt, erzürnt über diese Roheit, dem Wärter einen Peitschenhieb, indem sie ihn gleichzeitig aus ihrem Dienste entlässt. Nun schwört er Rache. Und die Rache des Gemütsmenschen besteht darin, dass er, während eine grosse Gesellschaft vornehmer Herren und Damen im Hause versammelt ist, die Türen des Käfigs aufzieht und die Löwen freilässt. Tückisch geduckt schleichen sie durch das Haus und suchen ihr Opfer. Der männliche Löwe begegnet auch der Herrin, aber dieser gelingt es, ihn zu besänftigen und in den Käfig zurückzutreiben. Inzwischen ist aber die Löwin noch unterwegs. Auch sie sieht man geduckt von Zimmer zu Zimmer schleichen und ihr Opfer suchen. Dieses ist nun aber nicht die Herrin, sondern der böse Wärter. Angstvoll flüchtet er sich von Zimmer zu Zimmer, zuletzt kriecht er unter ein Sofa. Die Löwin schleicht lauernd und suchend umher, plötzlich entdeckt sie ihn, stürzt aus ihn los und - natürlich ist der lebendige Mensch inzwischen durch eine Puppe ersetzt - gräbt ihre Zähne und Krallen in seinen Körper ein. Er stirbt eines elenden Todes, sie aber wird, ehe sie weiteres Unheil anrichten kann, erschossen.
Alles das ist natürlich nicht nach wahren Ereignissen aufgenommen, sondern von Schauspielern künstlich arrangiert. Zwar lebende Menschen und lebende Tiere, aber das Ganze schauspielerisch zugestutzt, und zwar mit solchen Schikanen, dass der Eindruck der grausigen Wirklichkeit entsteht. Und gerade deshalb entbehren diese Films jedes künstlerischen Wertes: Sie sind Natur in photographischer Aufnahme, nur roher und gemeiner als man sie jemals zu sehen bekommt, gleichzeitig in gewisser Hinsicht lügenhaft gefälscht. Es ist mir vollkommen unbegreiflich, wie künstlerisch empfindende Menschen eine Volksunterhaltung, die Derartiges bietet, überhaupt ernst nehmen, überhaupt künstlerisch werten können. Aber das ist für unsere zerfahrene Kultur, für die ästhetische Roheit selbst vieler, die in unseren Zeitungen zu Worte kommen, charakteristisch. Sie zetern darüber, wenn ein Maler wie Wenzel die Wirklichkeit zuweilen mit etwas zu wenig künstlerischer Abstraktion schildert, behaupten, seine Bilder seien Natur und keine Kunst. Derartige Scheusslichkeiten aber, die überhaupt nichts anderes als photographierte Natur sind, erscheinen ihnen immerhin bemerkenswert, vielleicht sogar schön.
Zu diesen Mordfilms gehören auch die "Historischen Dramen", die natürlich mit Vorliebe grässliche Szenen aus der Geschichte behandeln, z. B. die Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte oder die Bartholomäusnacht. Die historische Belehrung ist dabei natürlich nur Vorwand und wird von niemand ernst genommen. Ferner müssen hierher, so merkwürdig das auch erscheinen mag, die religiösem Films gerechnet werden, bei denen auch die grausigen und blutigen Ereignisse der biblischen Geschichte, z. B. der Kindermord, die Geisselung Christi und die Kreuzigung überwiegen. Der Zweck der Erbauung ist bei ihnen natürlich auch nur Vorwand. Sie verdanken ihre Einführung vielmehr rein geschäftlichen Gründen. Man will mit ihnen in katholischen Ländern während der Fastenzeit die Fortsetzung der Vorstellungen, die sonst verboten wären, ermöglichen. Und das Volk strömt in Massen zu diesen scheusslichen blutrünstigen Darstellungen, die natürlich auch nur mit bestimmten Tricks in Szene gesetzt werden können. Wie wenig derartige Aufführungen im Sinne der Kirche sind, ergibt sich daraus, dass den katholischen Priestern der Besuch des Kinematographen neuerdings durch päpstliches Breve verboten worden ist. Schade, dass sie sich so auch nicht an der Reform dieses Volksunterhaltungsmittels beteiligen können.
Es gibt ja Menschen, die die Passionsszenen in Oberammergau für Kunst halten. Aber was sind die dortigen Bühnenvorführungen, wo Geissel und Knüttel mit hohlem Geräusch auf ausgepolsterte Leiber und Beine niederfallen, gegen diese Scheusslichkeiten, bei denen das Blut in Strömen fliesst. Da kann man wirklich von den Unternehmern sagen: Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun
So berechtigt auch die Darstellung von Tagesereignissen an sich ist, und so wenig wir die aktuellen Films überhaupt verurteilen können, so verwerflich ist doch die Vorliebe für das Grausige, die sich auch bei ihnen zuweilen offenbart. Als vor einigen Jahren die Verbrecherin Grete Beyer ihren Bräutigam ermordete, indem sie ihn zuerst betäubte und dann, während er bewusstlos im Sessel lag, durch einen Schuss in den Mund tötete, konnte man wahrhaftig diese scheussliche Szene, natürlich von Schauspielern imitiert, wochenlang in einem Magdeburger Kinematographen sehen, ohne dass die Polizei dagegen eingeschritten wäre.
Man erinnert sich noch, dass vor einiger Zeit in einem ungarischen Dorfe mehrere hundert Menschen durch den Brand einer Scheune zugrunde gingen, in der sie sich, merkwürdigerweise bei geschlossenen Türen, zum Tanze versammelt hatten. Kurz darauf wurde in Zürich ein Film angekündigt: "An Ort und Stelle aufgenommen (!): Fünfhundert Totentänzer, Triumph der optischen Berichterstattung aus Ungarn." Abgesehen von der Lüge, die in den ersten Worten lag: Welche Roheit gehört dazu, eine solche Szene überhaupt mimisch darstellen zu lassen! Und was hat eine solche lügenhafte Vorführung mit Berichterstattung zu tun?
Aber man begnügt sich jetzt nicht mehr mit künstlichen Nachahmungen. Seit einiger Zeit werden Unglücksfälle, Revolten, Strassenaufläufe, Streiks u. dgl. auch nach der Natur aufgenommen. So konnte man z. B. vor einigen Tagen in den Zeitungen lesen, dass sich bei der Belagerung der beiden Automobilbanditen Garnier und Vallet in einem verbarrikadierten Hause in Nogent sur Marne mehrere Pariser Kinematographenoperateure an Ort und Stelle eingefunden hätten, um diese Belagerungsszene auf ihren Films festzuhalten. Man denke sich nur, unter dem fortwährenden Feuer der sich verteidigenden Banditen! So gross ist die Gewinnsucht dieser Leute, dass sie sich sogar der Lebensgefahr aussetzen. Was mögen sich wohl die Fabriken derartige sensationelle Films kosten lassen! Ich habe übrigens kürzlich einen ähnlichen Film gesehen. Erinnern kann ich mich nur an zwei hinter Bäumen stehende französische Kriminalbeamte, die sehr aufgeregt schienen, und an eine Salve oder Explosion im Hintergrunde, von der ich nicht erkennen konnte, wodurch sie veranlasst war.
Was für Erfolge diese Mord- [Mordfilms] und Raubfilms haben, zeigt der Brief eines Berliner Restaurateurs, den Conradt publiziert hat: "Mit Freude teile ich Ihnen mit, dass ich bis heute noch keinen Film besessen oder kennen gelernt habe, der so wie Ihr Film "Raubmord am Spandauer Schiffahrtskanal" angesprochen (!) und solche Anziehungskraft auf das Publikum ausgeübt hat. Mit einem Wort, dieser Film ist der wahre Kassenmagnet, da er das Publikum von Anfang bis zu Ende in atemloser Spannung hält. Ich habe diesen Film schon über 500 mal vorgeführt, manchen Tag 20- bis 25 mal.
Auf dem Umwege des Kinematographen werden jetzt dem Volke auch solche Schaustellungen dargeboten, die in natura nicht erlaubt sind. Ringkämpfe und Boxerkämpfe dürfen ja in unseren Zirken vorgeführt werden, obwohl sie übel endigen können, und sogar ein Dichter (!) wie Maeterlink hält es, wie soeben in den Zeitungen berichtet wird, nicht für unter seiner Würde, sich öffentlich in der Arena mit Berufsboxern, die ihm die Kinnbacken einschlagen können, zu messen. Aber zu Stierkämpfen haben wir es Gott sei Dank noch nicht gebracht, obwohl ein bekannter deutscher Kritiker, dem Velazquez viel zu realistisch ist, ihre ästhetischen Reize in einer spanischen Reisebeschreibung mit glühenden Farben geschildert hat. Im Kinematographen kann man dagegen Stierkämpfe fortwährend sehen. Ich frug einmal einen Polizeibeamten, wie man es rechtfertigen könne, wirkliche Stierkämpfe zu verbieten, Darstellungen derselben in bewegten Photographien dagegen zu erlauben. Er antwortete, bei wirklichen Stierkämpfen sei eben die Tierquälerei das Strafbare. Also die Tiere werden durch Gesetz geschützt, die Menschen aber nicht
Wir bilden uns etwas darauf ein, dass wir im Zirkus keine Gladiatorenkämpfe, keine wirklichen Kämpfe zwischen reissenden Tieren, keine Stiergefechte, Hahnenkämpfe u. dgl. dulden. Denn wir erkennen in diesen rohen Volksvergnügungen mit Recht ein Zeichen perverser Neigungen, Symptome einer dekadenten Kultur. Aber die Mord- und Verbrecherfilms - nicht nur diejenigen, welche diese verbotenen Schaustellungen zum Inhalt haben - sind um keinen Deut besser. Sie werden von den Kulturhistorikern der Zukunft einmal als eine Schmach des zwanzigsten Jahrhunderts gebrandmarkt und auf unser Schuldkonto gesetzt werden.
Und wer sind die Erfinder dieser Films, die Männer, die mit Aufbietung eines Scharfsinns, der einer besseren Sache würdig wäre, diese minderwertigen "Dramen" ausdenken und arrangieren? Ich kenne sie glücklicherweise nicht persönlich und würde mich auch gar nicht wundern, wenn ich plötzlich hörte, dass unter ihnen bedeutende Künstler sind. Soll ich sie nach ihren Taten beurteilen, so kann ich unter ihnen nur halbgebildete, ästhetisch gefühllose, ethisch gleichgültige, kurz geistig minderwertige Menschen vermuten, deren einzige wertvolle Eigenschaften eine gewisse organisatorische Fähigkeit, ein ausgesprochener Erwerbssinn und ein tiefes Verständnis für die perversen Instinkte des grossstädtischen Janhagels sind. Wenn wir in ihnen zum grossen Teil Ausländer zu erkennen haben, so ist das für uns nur ein geringer Trost. Denn der Erfolg ihrer Arbeit ist gerade bei uns in Deutschland, wie Sie gehört haben, besonders gross. Jedenfalls hat der Geschmack, der sich in diesen Produktionen offenbart, einen ganz internationalen Charakter. Es ist, wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen, etwa der Geschmack der englischen Detektivs, der amerikanischen Cow-Boys, der spanischen Toreros, der kalifornischen Goldgräber, der Geschmack von Zirkusdirektoren, Jockeys, Clowns, Menageriebesitzern, Tierbändigern, Athleten, Seiltänzern, Aushältern und Apachen! Und von solchen Leuten lässt sich das deutsche Volk seine ästhetischen Bedürfnisse vorschreiben, von ihnen bezieht es seine Kultur! Sollte es nicht endlich an der Zeit sein, dass wir uns aufraffen, dass die Gebildeten sich zusammentun, um gegen diese Unkunst, diese Volksvergiftung, diese Roheit zu protestieren?
In der Tat ist die Bewegung, die sich auf die Reform des Kinematographen bezieht, seit etwa 2 Jahren in vollem Gange. Aber von einer Einigkeit in bezug auf das, was zu geschehen hat, sind wir noch weit entfernt. Und zwar besonders deshalb, weil die Urteile über den Kinematographen sogar unter den Gebildeten noch sehr auseinandergehen. Immer wieder verwechselt man die Erfindung an sich mit den Schundfilms, auf die es ja hier allein ankommt. Immer wieder glaubt man Gott weiss was zu sagen, wenn man die hohe Kulturbedeutung des Kinematographen hervorhebt, während es sich doch nur darum handelt, gegen seine Ausschreitungen, gegen das, was man mit Recht seine Kinderkrankheiten genannt hat, einzuschreiten.
Zunächst einmal das eine, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: Von einer Unterdrückung des Kinematographen, an die wohl der eine oder andere gedacht hat, kann überhaupt nicht die Rede sein. Eine technische Erfindung, die so genial ist, die sich in so glänzender Weise entwickelt hat, kann nicht unterdrückt werden, ihre Unterdrückung wäre auch nicht einmal zu wünschen. Von seiner Bedeutung für die Wissenschaft, für die Schule, für Unterricht und Belehrung aller Art will ich hier gar nicht reden. Aber es kann auch keine Frage sein, dass ihm als Volksunterhaltungsmittel noch eine grosse Zukunft bevorsteht. Wenn erst einmal die technischen Mängel, die ihm jetzt noch anhaften, überwunden sein werden, wenn erst die farbige Photographie, was ja nur eine Frage der Zeit sein kann, in seinen Dienst getreten sein wird, wenn die Bilder erst einmal ausser der Bewegung auch die volle stereoskopische Wirkung, die Illusion des Raumes erreicht haben werden, wenn erst einmal der Phonograph so verbessert sein wird, dass sein Hinzutritt zum Kinematographen eine Steigerung der Naturwahrheit bedeutet, dann wird der Kinematograph eine Entwicklung erleben, deren Umfang sich jetzt noch gar nicht absehen lässt. Dann werden wir imstande sein, alles menschliche Handeln und natürliche Geschehen optisch und akustisch mit absoluter Treue zu fixieren, der Mitwelt zugänglich zu machen und der Nachwelt zu überliefern.
Gerade deshalb, weil wir diese Entwicklung voraussehen, weil wir ganz genau wissen, in welcher Richtung sie erfolgen wird, ist es notwendig, beizeiten Vorkehrung zu treffen, dass der Kinematograph sich nicht in lasterhafter Weise selbst ruiniert, dass er vielmehr seine Kräfte zusammenhält, um die grosse Kulturaufgabe, die ihm bevorsteht, zu erfüllen.
Es wird nun vielfach die Meinung vertreten, mit gesetzlichen oder polizeilichen Massregeln sei da nicht viel anzurichten, das Einzige sei, dass die Gebildeten sich zusammentäten, um einen Druck auf die Kinematographenbesitzer auszuüben, der dann auf die Filmfabrikanten zurückwirken und die Anfertigung der schlechten Films verhindern würde. Es komme darauf an, ein Programm guter Films aufzustellen, dahin zu wirken, dass diese möglichst viel gezeigt würden, und damit würde die Sache ganz von selbst besser werden. Ich halte das besonders nach den Ausführungen von Hellwig für vollkommen aussichtslos. Natürlich sollen wir alles das, was hier vorgeschlagen wird, auch tun, aber wir sollen darum das andere nicht lassen, d. h. wir sollen dahin wirken, dass die Schundfilms durch Gesetz unterdrückt werden. Ihre Zugkraft ist so ungeheuer gross, dass es ganz unmöglich erscheint, die grosse Menge von ihrer Verderblichkeit zu überzeugen. Hier können nur die Regierungen einschreiten, und zwar durch gesetzliches Verbot der Schundfilms. Die gegebene Form dafür wäre natürlich ein Reichsgesetz. Hier könnten Zentrum und Konservative ihre Macht einmal in glänzender Weise betätigen und sich einen wirklichen Ruhmestitel erwerben. Man fürchte sich nur nicht vor dem Schicksal der Lex Heinze. Denn hier handelt es sich ja gar nicht um Kunst. Hier handelt es sich vielmehr um groben Unfug, begangen durch die bewegte Naturphotographie. Diese Überzeugung muss mehr und mehr durchdringen. Dann kann uns der Erfolg nicht fehlen. Blosse Aufklärung des Publikums würde nicht genügen. Ihren Erfolg schlage ich sehr gering an. Schon deshalb, weil sogar viele Gebildete bis jetzt den entscheidenden Punkt nicht erkannt haben. Auch lesen die, für welche die Aufklärung bestimmt ist, keine Zeitungen und gehen in keine Vorträge über den Kinematographen. Wie viel ist schon gegen den Alkoholismus geschrieben worden, und wie oft kann man noch immer Eltern aus den ärmeren Volksschichten sehen, die ihren Kindern Bier oder gar Schnaps zu trinken geben. Diese Leute erfahren eben überhaupt nichts von einer solchen Reformbewegung. Deshalb ist auch der Standpunkt falsch, dass der Erwachsene die volle Verantwortung für sein Tun und Lassen habe. Es gehört ja nun einmal nach der modernen Auffassung zu den allgemeinen Menschenrechten, dass der Dumme und Ungebildete sich und seine Kinder körperlich und geistig ruinieren darf. Das wird niemals anders werden. Aber für den Staat ergibt sich daraus die Aufgabe, diese Selbstvernichtung auf ein möglichst geringes Mass zu beschränken. Das kann dem Kinematographen gegenüber nur durch Gesetz oder wenigstens durch möglichst einheitliche Polizeiverordnungen geschehen. Dass die Berliner Zensur nicht genügt, haben wir gesehen. Anderseits ist durch die Tatsachen erwiesen, dass eine gesetzliche Regelung über die Zulassung der Films noch überall gewirkt hat, dass der Kinematograph durch Ausmerzung der Schundfilms auf eine höhere Stufe gehoben worden ist. In Württemberg haben wir bisher wie gesagt, nur einige ministerielle Erlasse an die Polizeibehörden, die zu einer scharfen Kontrolle des Kinematographen ermahnen und dabei auf die notorische Schädigung, die die Jugend durch seinen Besuch erleidet, hinweisen. Das kann auf die Dauer nicht genügen, zumal da in Deutschland noch nicht einmal die Konzessionspflicht nach Paragraph 33 a der Gewerbeordnung besteht. Man denke sich: Eine Volksunterhaltung von der Art der hier skizzierten noch nicht einmal derselben Pflicht unterworfen wie Spezialitätentheater, Zirkusse, Kabaretts usw.! Hier klafft eine ungeheure Lücke in unferner Gesetzgebung, die selbst durch das energische Vorgehen einiger Polizeiverwaltungen, von denen sich diejenige in Stuttgart neuerdings mit grosser Energie der Frage annimmt, nicht ausgefüllt werden kann. [Verweis &4.]
Hellwig hat die Möglichkeiten des staatlichen Vorgehens vollständig aufgezählt, eingehend besprochen und im ganzen, wie mir scheint, richtig gewertet. Indem wir uns ein eigenes Urteil zu bilden suchen, haben wir vor allem zu fragen, ob sich eine Differenzierung der Kinder und der Erwachsenen empfiehlt. In vielen Städten ist Schülern der Besuch des Kinematographen nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Auch die hiesigen Schulrektorate haben sich neuerdings in dankenswerter Weise diesem Vorgang angeschlossen. Die Bestimmung hat aber im Grunde nur den Zweck, die Lehrer von der Verantwortung zu entlasten und diese auf die Eltern abzuwälzen. Denn an dem Selbstbestimmungsrecht der letzteren zweifelt natürlich in unserem liberalen Staat niemand. Ich halte dieses Verbot für ziemlich illusorisch. Es würde einen Nutzen haben, wenn man der Mehrzahl der Eltern zutrauen könnte, dass sie die Gefahr der Schundfilms richtig zu beurteilen und harmlose und Schundfilms voneinander zu unterscheiden vermöchten. Das ist aber nach dem früher Ausgeführten nicht der Fall. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Begleitung solcher Eltern, die für den Kino schwärmen, das Übel nur vergrössern würde. Ich bin auch nach meinen Beobachtungen fest davon überzeugt, dass kein Vater, der mit seinem Kinde ein Lichtspielhaus besucht, dasselbe in dem Augenblick verlassen würde, wo ein gefährlicher Film kommt. Und wer soll kontrollieren, ob die Begleiter wirklich Verwandte sind? Hellwig hat auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass Kinder, die keine Begleitung von Erwachsenen haben, sich vor dem Kino einem Menschen anschliessen, der sie an sich lockt, um sie seinen unsauberen Gelüsten gefügig zu machen, und dass sie auf diese Weise geradezu einem Wüstling zum Opfer fallen können.
Ebenso illusorisch ist die Festsetzung einer Altersgrenze. In der Regel wird als solche das 14. Jahr gewählt. In vielen Städten dürfen Kinder unter 14 Jahren den Kino nicht besuchen. Aber wer übernimmt die Kontrolle? Die Kinobesitzer sicher nicht und die Polizei wohl ebensowenig. Und was wäre damit erreicht? In Wirklichkeit ist die Gefahr für Kinder über 14 Jahren besonders bei den sexuellen Films viel grösser, als die für jüngere Kinder. In dieser Beziehung gibt es eine scharfe Grenze zwischen Kindern und Erwachsenen überhaupt nicht. Ästhetisch sind auch die meisten Erwachsenen Kinder. Ethisch sind besonders Lehrlinge, Tagelöhner und Dienstboten im Alter von 16-20 Jahren kaum widerstandsfähiger als Kinder unter 14 Jahren. Und welcher Nonsens liegt darin, dass man den Oberprimanern der Gymnasien und Oberrealschulen den Besuch des Kinos ohne Begleitung Erwachsener verbietet, dagegen die kaum aus der Volksschule entlassenen Kinder der ärmeren Klassen allein hineingehen lässt! Bringen diese etwa aus ihren Familien eine grössere Widerstandfähigkeit mit?
Durchaus unnütz, ja geradezu verwerflich ist die Bezeichnung gewisser Vorstellungen als "nur für Erwachsene" oder gar "nur für Herren
bestimmt. Ich habe immer gefunden, dass sich kein Mensch um diese Bestimmung kümmert, dass in solchen Vorstellungen immer auch Kinder, vom dritten Jahre an aufwärts, sitzen. Die Bestimmung hat also tatsächlich nur den Zweck der Reklame. Und zwar einer schmutzigen Reklame. Denn es soll damit dem Publikum angedeutet werden, dass es da unanständige Films zu sehen gibt. Es ist auch wiederholt beobachtet worden, dass dieser Zweck vollkommen erreicht wird, dass Erwachsene und Kinder ganz besonders zahlreich in diese Vorstellungen gehen. Solche Bestimmungen sollten deshalb ein für allemal verboten werden.
Auch die Differenzierung der Films, d. h. ihre Freigebung entweder für Erwachsene und Kinder oder nur für Erwachsene, würde eine Kontrolle erfordern, die erfahrungsgemäss nicht durchgeführt werden kann. Überhaupt habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Programme ganz ungenügend eingehalten werden, dass man angekündigte Films sehr oft - wahrscheinlich mit Rücksicht auf anwesende Honoratioren - weglässt, andere, die nicht auf dem Programm stehen, einschiebt. Lichtspielhäuser, in denen fortwährend ein Polizeibeamter anwesend ist, gibt es aber offenbar bisher nicht, oder nur in den grossen Städten. Auch muss man doch wohl sagen, dass, was unanständig ist, nicht dadurch anständig wird, dass Erwachsene es sehen. Was nicht anständig genug ist, um von Kindern gesehen zu werden, sollte auch Erwachsenen, jedenfalls Burschen und Mädchen im Alter von 16 - 20 Jahren nicht gezeigt werden. Lebemänner aber, an deren Moral nichts gelegen ist, sind nicht auf die öffentlichen Lichtspielhäuser angewiesen. Es wäre deshalb meines Erachtens richtig, einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern überhaupt nicht zu machen, statt dessen aber eine Zensur einzuführen, bei der nicht das Schamgefühl der Polizei und auch nicht das der "Durchschnittsmenschen", sondern das der Kinder und Frauen zugrunde gelegt wird. Denn diese sind es ja, die geschult werden sollen. Es ist wohl nicht ganz richtig, dass man mit Rücksicht auf das Vergnügungsbedürfnis erwachsener mehr oder weniger grobknochiger Männer die Seelen derer gefährdet, die notorisch den grössten Teil der Besucher des Kinotheaters bilden.
Etwas anders liegt die Frage, ob besondere Vorstellungen für Kinder veranstaltet werden sollen, wie das schon jetzt vielfach geschieht. Dagegen lässt sich natürlich nichts einwenden, da ja Kinder tatsächlich nicht alles verstehen, was Erwachsenen Vergnügen bereitet, und Erwachsene manches langweilig finden, was Kinder aufs höchste ergötzt. Doch hat das mit der Unterscheidung von Schundfilms und harmlosen Films nichts zu tun. Als Zeit für diese Kindervorstellungen käme natürlich nur der Nachmittag in Betracht. Nach 7 Uhr sollte man Kindern schon der Gesundheit wegen den Besuch des Kinematographen verbieten.
Was nun die Präventivzensur betrifft, so muss diese natürlich zentralisiert werden. Es ist schon rein technisch unmöglich, dass jede Polizeibehörde eine eigene Zensur einrichtet. Abgesehen von den grossen Kosten, die eine solche verursachen würde, treffen auch die Films oft erst wenige Stunden vor der Vorstellung ein, und ein Kinobesitzer, der sie dann erst der Zensur unterwerfen wollte, müsste damit rechnen, dass mehr als eine seiner Vorstellungen ins Wasser fiele. Auch sind die Programme meist schon von den Filmverleihgeschäften festgestellt, und die Beanstandung auch nur eines grösseren Films kann, da nicht immer Ersatz vorhanden ist, unter Umständen die ganze Aufführung in Frage stellen. Das sollte man keinem Kinobesitzer zumuten.
Natürlich wäre eine Zensur von Reichswegen, die in Berlin auszuüben wäre, das beste. Berlin besitzt schon jetzt das geeignete Beamtenpersonal, und da sich dort die meisten Kinotheater und auch die meisten Filmfabriken befinden, könnte sich dort auch am besten eine einheitliche Praxis entwickeln. Nur die wenigsten Polizeibehörden besitzen eigene Kinematographen, und den Kinobesitzern kann man nicht wohl zumuten, dass sie ihre Apparate zu kostspieligen Probevorführungen hergeben. Daraus geht aber unmittelbar hervor, dass die ganze Frage am besten durch Reichsgesetz geregelt würde. Ob dies so bald möglich sein wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls sollten die einzelnen Bundesstaaten, so lange wir kein Reichskinogesetz haben, in die Lücke eintreten. Mit der Zensur müsste natürlich auch eine fortwährende Kontrolle verbunden sein, die unnachsichtig jeden Übertretungsfall anzuzeigen hätte.
Was nun die Zusammensetzung der Zensurbehörde betrifft, so sollte man die Polizeiorgane durch ein Komitee gebildeter Männer und Frauen ergänzen. Lehrer, Ärzte, Geistliche, Mediziner und Künstler wären herbeizuziehen, die im fortwährenden Zusammenarbeiten mit der Behörde die Grundsätze ausbilden müssten, so dass sich möglichst bald eine einheitliche Praxis entwickelte. Denn die Arbeit ist z. B. in Berlin selbst, so gross, dass die gebildeten Polizeiorgane, die auch anderes zu tun haben, dafür nicht annähernd ausreichen. Die ungebildeten aber sollte man mit so heiklen Aufgaben nicht betrauen.
Die einzig mögliche Form der Zensur ist die kinematographische Vorführung der Films selber. Mit der Prüfung der eingereichten Beschreibungen ist es durchaus nicht getan, da daraus fast niemals erkannt werden kann, ob ein Film anstössige Szenen enthält oder nicht. Gerade die Vorliebe für befriedigende Schlüsse, für einen "moralischen" Inhalt ist hier durchaus irreführend.
Zensur und Kontrolle hätten sich natürlich auch auf die Plakate zu erstrecken, die manchmal noch schlimmer sind als die Films selber. Ein rheinischer Unternehmer reizte die Schaulust der Menge durch ein Plakat mit dem Bilde eines Scharfrichters, der einen abgeschlagenen bluttriefenden Kopf in der Hand hielt und zu dessen Füssen der Rumpf lag, aus dem das Blut in Strömen floss. (Conradt.)
Aber mit der Zensur und Kontrolle allein ist es nicht getan. Das Gesetz müsste auch einen Inhalt für die Richtung geben, in der die Zensur zu erfolgen hätte. Und da scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, dass die sexuellen und kriminellen Films einfach verboten werden. Natürlich wird das zunächst auf den Widerstand vieler Kinointeressenen stossen. Denn diese Films sind bisher wie gesagt gerade die Zugstücke gewesen, und es ist mit Bestimmtheit vorauszusehen, dass zunächst wenigstens durch ein solches Gesetz der Besuch der Kinos etwas leiden würde. Ja, man kann sogar vermuten, dass einige Kinos daraufhin eingehen würden. Hierin möchte ich einen ganz besonderen Vorzug der Massregel erblicken. Eine Verminderung der Zahl der schlechten Lichtspieltheater zugunsten der guten und vornehmen wäre nur im allgemeinen Interesse. Sind doch gerade in den letzten Jahren, und zwar infolge des Aufblühens der Kinoindustrie, auch eine Menge Theater - in der "Frankfurter Zeitung" [s. Verweis &1] war kürzlich von über 20 die Rede - eingegangen, und bei den Erörterungen darüber ist immer betont worden, dass das eigentlich kein besonderer Schade für die Kunst sei, denn es handle sich da wohl meistens um minderwertige Institute, die wenig zur Kultur beitrügen. Nun, ich glaube, es werden mir nach dem, was ich früher über das Verhältnis des Kinos zur Kunst gesagt habe, nicht viele Leser widersprechen, wenn ich behaupte, dass auch das schlechteste Theater immer noch besser ist als ein Kino, in dem Schundfilms vorgeführt werden. Und es ist nur wieder ein Beweis für die völlige Verwirrung der ästhetischen Begriffe, wenn einige moderne Ästheten den weniger guten Theatern, die auf diese Weise eingehen, keine Träne nachweinen möchten, dafür aber eine recht grossartige Entwicklung des Kinos in seiner jetzigen Gestalt für wünschenswert halten. Die Dinge liegen vielmehr so, dass das Theater überhaupt, das gute sowohl wie das schlechte, tatsächlich durch das Aufblühen der Kinoindustrie geschädigt worden, der Theater- [Theaterbesuch] und Konzertbesuch infolge der vielen Kinotheater nicht unbeträchtlich zurückgegangen ist. Und es kann wohl für keinen, der die Verhältnisse kennt, ein Zweifel sein, dass dies ein Verlust an Kultur, an geistigen Werten bedeutet, mag man auch das Eingehen kleiner unbedeutender Theater oder ihre Verwandlung in Kinotheater sonst so leicht nehmen, wie man wolle.
Für geradezu gefährlich aber halte ich die mehrfach ausgesprochene Meinung, dass die Dinge sich schon von selbst günstig entwickeln würden, dass der Kino ja längst aus dem besten Wege zur Reform sei, indem die Kinointeressenten selbst in richtiger Erkenntnis der Sachlage aus gewisse Massregeln, z. B. eine strengere Zensur drängten. Die Tatsache selbst ist allerdings nicht zu bezweifeln, und es mag auch einsichtige und gebildete Kinobesitzer geben, die ihr Schäfchen ins Trockene gebracht hatten und sich nun besinnen, dass ihnen ausserdem auch gewisse Kulturverpflichtungen obliegen. Dazu kommt, dass die Einführung einer einheitlichen Kinozensur auch für die Kino-Interessenten unmittelbare pekuniäre Vorteile haben würde, insofern sie dann nicht bei der Anfertigung oder Erwerbung eines Films immer mit der Möglichkeit seines Verbotes zu rechnen hätten. Aber von selbst, darüber täusche man sich nur ja micht, wird der Schundfilm nicht verschwinden. Dazu ist er zu beliebt, dazu sind zu grosse Kapitalien in Film angelegt.
Was aber sollen wir tun, wenn die Gesetzgebung uns im Stich lässt, wenn weder das Reich noch die Einzelstaaten mit kräftiger Hand in dieses Wespennest hineingreifen wagen? Nun, dann müssen wir es eben machen, wie es schon in mehreren Städten gemacht worden ist: Männer und Frauen aus den massgebenden Kreisen müssen sich zu Vereinen oder Komitees zusammenschliessen und mit den Kinobesitzern in Verhandlung treten, um sie zur Ausmerzung der Schundfilms zu veranlassen. Wie man hört, ist diese freiwillige Zensur in mehreren Städten von Erfolg begleitet gewesen, und man kann sich ja auch denken, dass kein Kinobesitzer sich gern auf die Dauer in einen Gegensatz zu der besseren Gesellschaft der Stadt setzen wird, da seine Existenz dadurch doch einigermassen bedroht wäre. Und wo das nicht geht, da sollten die Gebildeten sich wenigstens in geistiger Gemeinschaft zusammentun und jeder in seiner Art dem Übel zu wehren suchen. Sie sollten sich für zu gut halten, Lichtspieltheater zu besuchen, in denen ihnen solcher Schund geboten wird. Ein Kinotheater, das Schundfilms führt, sollte überhaupt nicht besucht, vielmehr einfach geboykottet werden. Und zwar nicht nur um der Moral willen, die wir unserem Volke doch erhalten wollen, sondern vor allen Dingen um der Kunst willen, die durch diese Afterkunst, diese Unkunst in ihrem Bestande bedroht ist, geistig und materiell geschädigt wird.
In dieser Beziehung kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass der Kino seiner ganzen Natur nach nichts mit Kunst zu tun hat, ja geradezu kunstfeindlich ist. Und das wird im Verlaufe seiner weiteren Entwicklung immer mehr zutage treten. Je mehr sich der Kinematograph der Natur nähert, umsomehr wird er sich von der Kunst entfernen. Das könnte im ersten Augenblick merkwürdig erscheinen, da ja auch die Kunst nach Illusion strebt. Man wird es aber sofort verstehen, wenn man sich erinnert, dass die künstlerische Illusion etwas ganz anderes als wirkliche Täuschung ist. Das Wesen der Kunst besteht nicht in der Täuschung, sondern in der bewussten Selbsttäuschung. Künstlerisches Schaffen ist nicht ein einfaches Reproduzieren der Wirklichkeit, sondern ein Übersetzen derselben in eine andere Sprache, eben in die Sprache der Kunst. Nicht um Reproduktion, sondern um Abstraktion handelt es sich dabei. Allerdings will auch die Kunst den Eindruck der Wirklichkeit hervorrufen, aber sie will es nur bis zu einem gewissen Grade, d. h. nur soweit wie ihre technischen Mittel es gestatten. Je nach der Art dieser technischen Mittel, d. h. je nachdem ihr nur Farben oder Töne oder Bewegungen oder Worte zu Gebote stehen, muss sie die Natur umgestalten, ihren Darstellungsmitteln anpassen. Diese Umgestaltung und Anpassung nennen wir Stil. Alle Vereinfachungen, Akzentuierungen, Steigerungen, Abschwächungen usw., die die Kunst mit der Natur vornimmt, haben nur den einzigen Zweck, mit den technischen Mitteln die ihr zu Gebote stehen, Illusion zu erzeugen. Der Kinematograph aber strebt danach, eine vollständige, restlose Wiedergabe der Wirklichkeit zu bieten. Je mehr es ihm gelingt, alle Eigenschaften der Natur, Form, Farbe, Licht, Bewegung, Raum, Geräusch usw. darzustellen, genau der Wirklichkeit entsprechend zu reproduzieren, umsoweniger Stil wird er haben, umsomehr wird er von der Kunst abrücken. Sein Weg führt nicht zur Kunst, sondern weg von ihr, in entgegengesetzter Richtung.
Daraus ergibt sich aber, dass der Kinematograph, je mehr er sich technisch ausbilden wird, um so mehr sich darauf wird beschränken müssen, das Leben einfach wie es ist, zu reproduzieren. Er wird sein eigentliches Ziel immer mehr darin erkennen müssen, Anschauung des wirklichen Geschehens zu vermitteln, den Menschen das von der Welt zu zeigen, was im natürlichen Verlauf der Dinge, ohne künstlerische Nebenzwecke geschieht, und was aus irgendeinem Grunde nicht von allen oder nur von wenigen erlebt werden kann. Und daraus ergibt sich nun ein ausserordentlich reiches, ungeheures Programm, das ich Ihnen zum Schluss kurz skizzieren möchte.
Da wir es nur mit dem Kinematographen als Volksunterhaltungsmittel zu tun haben, kann ich seine Verwendung im Dienste der Wissenschaft nicht ausführlich behandeln. Nur insoweit möchte ich sie erwähnen, als sie auch für Unterhaltungszwecke nutzbar zu machen ist. In dieser Beziehung aber muss darauf hingewiesen werden, dass es eine Menge wissenschaftlicher Films gibt, die auch für weitere Kreise grosses Interesse haben, von ihnen als ein willkommenes Mittel der Unterhaltung und Belehrung begrüsst werden würden. Inwieweit sich unsere Volkshochschulbewegung dieses Mittels schon bedient, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls würde sie davon den grössten Nutzen ziehen. Das beweist das immer stärkere Eindringen der wissenschaftlichen Films auch in die Programme derjenigen Lichtspielhäuser, die vorwiegend der Unterhaltung dienen. Diese Entwicklung kann nicht lebhaft genug unterstützt werden, denn das Feld, das sich da dem Kinematographen eröffnet, ist sehr gross.
In erster Stelle sollte dabei die Medizin stehen. Denn in medizinischer, speziell hygienischer Richtung liegen nicht nur die Hauptmängel unserer Volksbildung, sondern liegt auch tatsächlich die Sehnsucht weiter Volkskreise nach Belehrung und Unterhaltung. Das hat die hygienische Ausstellung in Dresden zur Genüge bewiesen. Vieles von dem, was dort gezeigt wurde, könnte unmittelbar auch in das Programm unserer Lichtspielhäuser aufgenommen werden. Wer interessierte sich nicht für das Wesen der Infektionskrankheiten, für die Bekämpfung der grossen Volksepidemien und Tierseuchen, für die Form und Bewegung der Bazillen, die Hygiene der Wohnung und Kleidung, für das Leben in den Heilstätten, den Betrieb der Krankenhäuser, die erste Hilfe bei Unglücksfällen, die Tätigkeit des roten Kreuzes? Alles das sind Dinge, die als Bewegungserscheinungen vollkommen klar, ja geradezu erschöpfend dargestellt werden können und zum Teil längst dargestellt sind. Nur müsste man sich entschliessen, mündliche Erläuterungen hinzuzufügen, und es wird natürlich sehr darauf ankommen, diese so kurzweilig zu gestalten, dass das Publikum durch sie nicht gelangweilt wird.
Für die Erkenntnis physiologischer und pathologischer Erscheinungen, ja für das Studium vieler Naturerscheinungen überhaupt, ist die neue Ausbildung der Mikrokinematographie und der Röntgenkinematographie von ungeheurer Bedeutung. Dadurch dass der Ablauf der Bewegung je nach Bedürfnis im Bilde verlangsamt oder beschleunigt werden kann, dass man in das Innere des Körpers hineinzudringen imstande ist, vermittelt uns der Film eine Menge Erscheinungen, die wir in der Natur überhaupt nicht oder nur ganz unvollkommen zu sehen vermögen. Ich erinnere nur an die Bewegungserscheinungen des Menschen- [Menschenreichs], Tier- [Tierreichs] und Pflanzenreichs, an laufende Menschen, galoppierende Pferde, auskriechende Schmetterlinge, einen Bienenstaat bei der Arbeit, aufblühende Blumen und dergl. Und wer interessierte sich nicht für die physiologischen Funktionen des Körpers, z. B. die Bewegung der Lunge beim Atmen und des Magens bei der Verdauung? Man glaube nur ja nicht, dass derartige Vorführungen für das Volk langweilig wären. Es kommt nur auf die Art der Erläuterung an, und sie werden ihm ebenso interessant sein wie Entkleidungsszenen oder Hinrichtungen. Natürlich wird dabei eine gewisse Auswahl stattfinden müssen. So interessant es für einen Mediziner sein mag, einen grossen Chirurgen bei einer schweren Operation zu beobachten, so verkehrt wäre es, der grossen Menge derartige Bilder darzubieten. Dem Volke, das den Sinn der Vivisektion doch nicht versteht, sollte man nicht Experimente an lebenden Tieren vorführen, die ihm Anlass zu abfälliger Kritik geben könnten.
Das Grässliche und Grausame hat überhaupt im Kinematographen nur da seine Stelle, wo seine Vorführung im Sinne der Volkswohlfahrt von Nutzen sein kann. So ist z. B. der Kinematograph wohl imstande, die Mässigkeitsbestrebungen durch Vorführung der Folgen des Alkoholgenusses zu unterstützen, und für die Verbreitung der Tierschutzbestrebungen haben sich Photographien aus den Reiherkolonien und ähnliches schon gewährt. Sodann kann man gewiss eine Förderung des Sports und der Leibesübungen darin ernennen, dass alle Arten von Sport, Bergkraxeln, Skilauf, Eislauf, Rodeln kinematographisch vorgeführt werden. Derartige Films gibt es, besonders in den skandinavischen Ländern, schon in grosser Zahl; bei uns scheinen sie weniger beliebt zu sein. Die grosse Popularität des Sports und die Möglichkeit, die Bewegungen im Bilde zu verlangsamen und dadurch zu verdeutlichen, sollte ihnen, wie ich meine, eine gewisse Volkstümlichkeit sichern. Kann man sich etwas Schöneres denken als die bewegte Darstellung eines Sports, dessen Wesen ganz auf der Bewegung beruht? Auch die Tätigkeit des Wandervogels und der Pfadfinder, neuerdings die Übungen von Jungdeutschland müssten dem Kinematographen noch in höherem Masse als bisher zugänglich gemacht werden. Es sollte sich mehr und mehr die Überzeugung Bahn brechen, dass der Kinematograph das beste Werbemittel für alle Volkswohlbestrebungen ist. Es wird gewiss noch dahin kommen, dass jeder Verein seinen Kinematographen hat, und selber diejenigen Aufnahmen nach seiner Tätigkeit macht, die ihm für die Propaganda am meisten geeignet erscheinen.
Den Kinematographen im Dienste der inneren und äusseren Mission hat Pfarrer Conradt ausführlich behandelt. Er soll zeigen, "wie die Kräfte des Evangeliums in der Not des Lebens wirksam werden.
Wohltätigkeitsanstalten wie Hoffnungstal bei Berlin, die Frankeschen Stiftungen in Halle, das Rauhe Haus in Hamburg, die Bodelschwinghschen Anstalten in Bielefeld, das Diakonissenhaus in Kaiserswerth, das seien Themata für den Kinematographen, die gewiss mehr Interesse erregen würden als erkünstelte Dramen. Die Pflege der Epileptiker, das Leben in einer Irrenklinik, in einer Wanderherberge, in der Arbeiterkolonie, in Waisenhäusern, Ferienkolonien usw. sollte geschildert werden, um zu zeigen, was jetzt alles für Kranke und Kinder geschieht, um verkehrte Anschauungen, die über manche dieser Anstalten bestehen, zu widerlegen. Hier könnte der Kinematograph einmal über allerlei Lebensgebiete die Kontrolle üben, wie das Volk ihnen gegenüber mit Recht fordert.
Eine andere Gattung von Films musste der normalen menschlichen Arbeit gewidmet sein, dem Handwerk, der Industrie, der Technik, der Landwirtschaft. Wie viel seltene und schwierige Handwerksmanipulationen gibt es, für die man sich sehr interessiert, die man aber nur selten oder nie zu sehen bekommt! Wenn man das Interesse beobachtet, mit dem die feineren Arbeiten der Töpferei und Weberei, der Holzschnitzerei und Intarsia-Arbeit in den improvisierten Werkstätten unserer grossen Ausstellungen vom Publikum verfolgt werden, muss man da nicht annehmen, dass diese Vorgänge, die doch ganz auf der Bewegung beruhen, auch im Kinematographen weite Kreise fesseln würden? Man denke dann an die Arbeit in grossen Fabriken, an die Gewinnung der Rohprodukte, an die Vorführung interessanter und neuer Maschinen in voller Tätigkeit, an die Darstellung landwirtschaftlicher Betriebsformen, deren Kenntnis doch nicht nur für Handwerker, Techniker und Bauern einen praktischen Wert hat! So lässt schon jetzt die russische Regierung die Kenntnis neuer landwirtschaftlicher Betriebsformen durch den Kinematographen auf dem Lande verbreiten, um den Bauernstand dadurch zu heben. Und bei uns, wo leider jedermann studieren will, wäre es vielleicht ein Mittel, junge Leute den technischen Berufen oder dem Handel zuzuführen, wenn man ihnen recht oft die technischen und industriellen Vorgänge zeigte. Es müsste doch mit merkwürdigen Dingen zugehen, wenn unsere männliche Jugend sich nicht erheblich mehr für den Betrieb in den Kruppschen Stahlwerken zu Essen, in den Schiffswerften zu Stettin und Danzig, in den Luftschiffwerkstätten zu Friedrichshafen interessieren würde, als für sentimentale Dramen und erlogene Detektivgeschichten.
Wieder eine andere Gattung müssten die politischen Films sein. Auch dafür bestehen schon Ansätze, die sich weiter ausbauen liessen. Unter politischen Films verstehe ich alle, die mit dem Zweck der Unterhaltung den Nebenzweck verbinden, das staatsbürgerliche Gefühl bei der Jugend und bei den Erwachsenen zu stärken. Dazu gehören Bilder, welche die Begeisterung für Heer und Flotte, für Kolonien, für militärisches Flugwesen, für Expeditionen und Forschungsreisen, überhaupt für die ganze Betätigung des Deutschtums im In- [Inlande] und Auslande zu wecken geeignet sind. Bilder aus dem Leben der Armee und der Marine, Manöverszenen, Paraden, Flottenbewegungen, Szenen vom Kasernenhof und Schiessplatz existieren ja schon in grosser Zahl. Jetzt müssten noch Darstellungen aus der militärischen Tätigkeit der Lustschiffe und Aeroplane hinzukommen. Da alle diese Darstellungen auch für den Unterricht im Truppenkörper selbst Verwendung finden könnten und ohne Zweifel bald auch tatsächlich finden werden, könnte die Anfertigung solcher Films mit keinem allzu grossen Risiko verbunden sein. Und unsere Knaben werden sich gewiss mehr für Kavallerieattacken, abprotzende Batterien, feuernde Maschinengewehrabteilungen und manövrierende Panzerschiffe interessieren als für französische Ehebruchsgeschichten und Entkleidungsszenen. Überlassen wir diese denen, die sie erfunden haben, und gegen die wir einst werden kämpfen müssen
Vorträge über Kolonialwesen gehören schon jetzt zu den Hauptattraktionen der kleineren Städte. Wie aber könnte erst das Interesse für unsere Kolonien geweckt werden, wenn man die Arbeit in den Plantagen und auf den Diamantfeldern, das Leben der Beamten, der Farmer und der Schutztruppler in bewegten Bildern vorführen wollte? Natürlich müsste, wie schon Professor Gaupp angedeutet hat, zu all diesen Films die mündliche Erklärung hinzukommen, wenn sie den richtigen Nutzen stiften und das Publikum fesseln sollten. Wie interessant und gleichzeitig im allgemeinen Interesse wären da Belehrungen über die Chancen der Auswanderung, über die Notwendigkeit von Eisenbahnen in den Kolonien, über das Leben der Farmer, über die Tätigkeit der Frauen und das Bedürfnis weiblichen Zuzugs! Hier kann man wirklich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, Belehrung und Unterhaltung auf einmal darbieten. Ich sehe die Zeit kommen, wo der Staat selbst sich dieser Gattung annimmt und politische Films zum Zwecke der Volksaufklärung herstellt. Und wer etwa behaupten wollte, dass diese Films das Volk nicht so interessieren würden wie die "Kunstfilms", und dass sie deshalb stets im Programm zurücktreten würden, den könnte man darauf hinweisen, dass es schon manche vornehme Lichtspieltheater gibt, in denen vorwiegend belehrende Films vorgeführt werden. Der Staat hätte ja auch schon jetzt ein einfaches Mittel, ohne direktes Verbot der Schundfilms, der belehrenden Gattung aufzuhelfen. Er brauchte nur die unterhaltenden Films zu besteuern, die belehrenden dagegen steuerfrei zu lassen. Das wäre schon deshalb billig, weil dem Kinobesitzer durch die Notwendigkeit der mündlichen Erläuterung besondere Kosten erwachsen müssen. Wenn erst einmal die unterhaltenden Films der schlimmsten Sorte verboten, die harmlosen mehr oder weniger hoch besteuert sind, die belehrenden dagegen steuerfrei bleiben, dann wird es sich eben für die Kinematographenbesitzer nicht mehr lohnen, ihren Vorstellungen durch die "Dramen" oder "Kunstfilms" einen pikanten Charakter zu geben. Das wäre gewiss die beste Art, die Kinointeressenten und das Publikum zu erziehen. Nur so würde erreicht werden, dass die belehrenden und aufklärenden Films mehr und mehr an die Stelle der Schundfilms träten. Der Staat aber würde durch ein solches Vorgehen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er würde die Verbildung des Volkes hindern und seine Aufklärung fördern.
Dabei müsste allerdings darauf gesehen werden, dass die belehrenden Films nicht zu sehr überhand nähmen, damit nicht die Kinovorstellungen geradezu einen gouvernantenhaften Charakter erhielten. Vielmehr sollte ihr unterhaltender Charakter möglichst gewahrt bleiben und sich auch in der Zusammensetzung der Programme aussprechen.
Hier wäre nun besonders zu betonen, dass Unterhaltung nicht nur durch "Kunstfilms" geschaffen werden kann. Auch nach Loslösung des Kinematographen von der Kunst bleiben noch viele Gebiete, die als rein unterhaltende eine grosse Zugkraft ausüben werden.
Zu ihnen rechne ich besonders die Tierdarstellungen. Wenn für Künstler die Darstellung der gewöhnlichen Tierbewegungen von Interesse sein würde, wenn Retter durch die analysierende Vorführung der Gangarten des Pferdes unmittelbaren Nutzen hätten, so würden Kinder natürlich am meisten Interesse an der Darstellung wilder, besonders reissender Tiere haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass der Kinematograph in ähnlicher Weise für die Fixierung der Lebensgewohnheiten der Löwen und Tiger benutzt wird, wie Schillings den Momentphotographen und das Blitzlicht dafür benutzt hat. Von englischen Reisenden liegen in dieser Beziehung soviel ich weiss schon Anfänge vor. Ausserdem haben wir in den letzten Jahren eine Reform der Zoologischen Gärten erlebt, die es möglich macht, auch die Tiere in unseren modernen Tierparks nahezu im Stande der Wildheit vor Augen zu führen. Und es ist nicht einzusehen, warum ein Stoff, der die Kinder in der Wirklichkeit so interessiert, und dessen Anschauung doch den Provinzlern völlig versagt ist, nicht auch in der bewegten Photographie seine Anziehungskraft ausüben sollte. Die Hagenbeckschen Aufnahmen haben ja auch gezeigt, welches Interesse die Kinder diesen Darstellungen entgegenbringen. Unsere zoologischen Gärten sollten alle ihren eigenen Kinematographen haben und nach ihrem Tierbestande auf Grund der Auswahl und Anordnung der Direktion Films für den Handel herstellen.
Eine vorwiegend unterhaltende Gattung sind dann die Reisefilms. Wer kein Geld hat, grosse Reisen zu machen, dem bietet der Kinematograph schon jetzt eine Art Ersatz dafür. Die alten Panoramen und Dioramen, die doch auch ihr Publikum hatten, sind durch ihn völlig verdrängt worden. Für die Darstellung von Eisenbahn- [Eisenbahnfahrten] und Automobilfahrten, Seereisen, Bergtouren, Schlittenexpeditionen usw., wobei die Art, wie die Bewegung des Vehikels die Gegenstände der Natur am Auge des Reisenden vorüberführt, im Kinematographen genau wiedergegeben wird, ist diese Technik ein geradezu klassisches Veranschaulichungsmittel. Schon jetzt fehlt der Kinematograph bei keiner grosen Expedition. Geographie und Völkerkunde werden ohne ihn nie mehr auskommen können.
Der reinen Unterhaltung dienen sodann die aktuellen Films, d. h. die Darstellungen von Tagesereignissen, die jedermann interessieren. Sie brauchen ja nicht notwendig roh-sensationell zu sein und könnten dennoch das Publikum ebenso fesseln wie die kurzen Berichterstattungen in den Zeitungen. Der Einwand, dass es sich da meist um nichtige Dinge handele, deren Kenntnis kaum erstrebenswert sei, ist wohl vom idealen Standpunkt aus richtig, gilt aber nur für die Gebildeten, nicht für die zahlreiche Schar der einfach Neugierigen, die in der Abgeschiedenheit ihres Daseins irgend etwas von der Welt erfahren möchten. Man sollte deshalb bei allen Staatsaktionen, Krönungen, Monarchenbegegnungen, Parlamentseröffnungen, Gebäudeeinweihungen, Denkmalenthüllungen, Schiffstaufen usw. grundsätzlich den Kinematographen zulassen. Bisher hängt die Aufnahme solcher Vorgänge von vielen Zufälligkeiten ab, so dass die Films tatsächlich meistens schlecht sind. Ausserdem werden sie in der Regel zu schnell und immer ohne Erläuterungen vorgeführt. Die Folge davon ist, dass das Publikum sich bei ihnen langweilt und die Zeit nicht erwarten kann, bis der sensationelle dramatische Film kommt. Man sollte dieses Gebiet, wenn es auch für die Kultur nicht viel bedeutet, noch mehr als bisher ausbauen. Das läge auch im Interesse der Kulturgeschichte. Was gäben wir heute darum, wenn wir wichtige Ereignisse im Leben Luthers, Friedrichs des Grossen oder Bismarcks im bewegten Bilde an unseren Augen vorüberführen könnten! Wenn man sieht, welchen Erfolg unsere Wochenzeitschriften mit ihrer bildlichen Berichterstattung seit Einführung der Autotypie gehabt haben, und wenn man bedenkt, wie unvollkommen die einfache Momentphotographie ist, aus der man in der Regel die Hauptsache gar nicht deutlich sieht, so muss man sich sagen, dass der Kinematograph geradezu bestimmt scheint, an ihre Stelle zu treten. Es muss so weit kommen, dass jeder, der sich für die Tagesereignisse interessiert, am Schluss der Woche die bekannten Bilder der Wochenübersichten an sich vorüberziehen lässt. Ich glaube nicht, dass diese Attraktion dem Interesse für die Schundfilms irgend etwas nachgibt. Natürlich müssten Ereignisse, die verhetzend wirken könnten, wie Treibjagden, politische Gerichtsverhandlungen, Arbeiterstreiks, Exzesse u. dgl. ausgeschlossen werden - von den künstlichen Inszenierungen grausiger Tagesereignisse ganz zu schweigen. Auch bei diesen Films wäre der Hinzutritt des Wortes, wenn auch nur in der Form kurzer Zeitungsnotizen, wünschenswert.
Alles, was ich bisher genannt habe, hat mit Kunst nicht das geringste zu tun, vielmehr ist es nur eine Bestätigung des Satzes, dass der Kinematograph sich immer mehr von der Kunst weg entwickeln wird. Gleichwohl bleiben auch dann noch gewisse Beziehungen des Kinematographen zur Kunst bestehen, und diese haben natürlich für seine Benutzung als Unterhaltungsmittel eine besondere Bedeutung. Der Kinematograph wird auch in Zukunft ein wichtiges Mittel sein, künstlerische Leistungen, deren Wesen auf der Bewegung beruht, zu fixieren und auf dem Wege dieses Surrogates weiteren Kreisen zugänglich zu machen.
Das gilt schon für das Gebiet der niederen Künste, die man auch als artistische Wertigkeiten bezeichnet. Solange die Darbietungen des Zirkus und der Spezialitätentheater eine so grosse Anziehungskraft auf das Volk ausüben, wie das jetzt der Fall ist, wird auch die viel billigere kinematographische Vorführung der Leistungen von Kunstreitern, Seiltänzern, Parterre- [Parterregymnastikern] und Trapezgymnastikern, Jongleuren und Exzentrik-Clowns weite Kreise interessieren. Es wäre einfach Prüderie oder blasses Ästhetentum, wenn man sie dem Kinematographen vorenthalten wollte. Natürlich sind die Kunststücke aller dieser Leute in der Wirklichkeit viel eindrucksvoller als im bewegten Bilde, aber der Unterschied ist doch lange nicht so gross wie beim Drama, und wenn es irgend etwas gibt, was verhältnismässig treu in dieser Form reproduziert werden kann, so sind es gewiss die Bravourleistungen des Körpers. Die Konkurrenz, die dem Zirkus daraus erwächst, würde wahrscheinlich nicht sehr gross sein und auch keine für die Kultur wertvolle Volksunterhaltung treffen.
Unter den höheren Künsten aber ist an erster Stelle der Tanz zu nennen. Da er schon in Wirklichkeit eine starke Abstraktion von der Natur bedeutet, indem er nämlich auf das Wort verzichtet, ist bei ihm eine fast völlig adäquate Darstellung im bewegten Bilde möglich. Haben wir doch Tanzdarstellungen sogar in Form unbewegter plastischer oder malerischer Kunstwerke schon aus der Antike in grosser Zahl. Man sollte denken, dass der Kinematograph sich dieses Gebietes schon längst bemächtigt haben müsste. Lässt sich doch gewiss kein besseres Surrogat einer Kunst denken, deren Wesen ganz auf der Bewegung beruht. Dennoch erinnere ich mich nicht, jemals einen wirklichen Kunsttanz modernen Charakters im Kino gesehen zu haben. Immer nur fade Balletts mit kurzen Röckchen und Trikots, und das in einer Zeit, in der die Duncan und Dalcroze doch wahrhaftig gezeigt haben, in welcher Richtung eine Reform des Tanzes möglich wäre. Natürlich müsste bei Tanzdarstellungen die Musik dem Rhythmus völlig angepasst werden. Ob dazu das Grammophon schon jetzt genügend ist, möchte ich bezweifeln. Jedenfalls ist es aber mit einem verstimmten Klavier, aus dem ein musikalischer Handwerker gefühllos und ohne jede Beziehung zu dem Bilde herumtrommelt, nicht getan. Es ist wohl nicht zu viel verlangt, dass sich auch die kleineren Kinobesitzer in dieser Beziehung zu einigen Opfern bequemen.
An zweiter Stelle käme die Pantomime in Betracht. "Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze." Das ist eine bittere Wahrheit. Dagegen die Kunst des Pantomimen, die des Wortes entbehrt, kann schon jetzt ziemlich genau für die Dauer fixiert werden. Das Spiel grosser Schauspieler ist, soweit es in der Bewegung und dem Gesichtsausdruck besteht, dem Kinematographen völlig zugänglich. Das wird nicht nur eine wichtige Schule für die Schauspielkunst sein, sondern könnte auch der Ausgangspunkt einer neuen Kunstgattung werden. Man hat in den letzten Jahren wiederholt von einer Wiederaufnahme und Reform der Pantomime gehört. Besonders in Frankreich scheinen schon mehrfach Versuche in dieser Richtung gemacht worden zu sein. Bei uns liegt dieses Gebiet noch sehr im argen. Meines Erachtens wäre eine Weiterbildung des Tanzes zur Pantomime sehr zu wünschen. Man ist, wie ich glaube, heute zu sehr in der Vorstellung des Gesamtkunstwerks im Sinne R. Wagners befangen. Und doch ist es eine Tatsache, dass die Verbindung des Dramas mit der Musik so lange eine unvollkommene Kunstform bleiben wird, wie man sich darauf kapriziert, das Wort, das Hauptmittel des Dramas, im Kunstwerk beizubehalten. Bayreuth mag dieses Problem verhältnismässig gut gelöst haben. Für das Theater im allgemeinen, besonders für unsere grossen Opernhäuser wird es immer unlösbar bleiben. Wer den Text des "Rosenkavaliers" nicht vorher genau gelesen hat, versteht von dem raschen Sprechgesang, schon wenn er im zweiten Parkett sitzt, kein Wort. Das wird auch nie anders werden. Es ist kein Zufall, dass wir von hervorragenden Malern wie Böcklin und Feuerbach sehr abfällige Äusserungen über das Wagnersche Gesamtkunstwerk haben. Nicht über den Charakter der Musik, sondern über den Anspruch, eine Gesamtwirkung zu erzielen, die sich ohne Schädigung der einzelnen Künste unmöglich erzielen lässt. Zwei Künste nun, die sich sehr gut miteinander verbinden lassen, ja die geradezu aufeinander angewiesen zu sein scheinen, sind Pantomime und Musik. Die auf der Bühne gespielte Handlung veranschaulicht den Gefühlsgehalt der Musik, sie ist gewissermassen das Programm, das dem Zuschauer den Fortgang der Vorstellungen und Gefühle veranschaulicht, denen die Musik Ausdruck geben will. Die Musik hinwiedernm verdeutlicht den Inhalt des Gespielten in einer Weise, dass die Handlung restlos verstanden werden kann. Ich glaube in der Tat, dass in dieser Richtung die Zukunft unseres Theaters liegt, soweit es nicht einfaches Schauspiel ist und bleiben will. Wenn das aber richtig ist, so würde sich damit dem Kinematographen ein ungeheures Feld der Tätigkeit eröffnen. Natürlich würde er niemals mit der wirklichen, auf der Bühne vorgeführten musikalischen Pantomime wetteifern können, ebensowenig wie er jemals den Tanz ersetzen könnte. Aber er würde ein sehr gutes und willkommenes Surrogat dieser beiden Künste sein. Schliesslich sind ja auch die "Dramen" oder "Kunstfilms", die im jetzigen Kino vorgeführt werden, nichts anderes als Pantomimen. Nur dass sich ihr Inhalt, wie wir gesehen haben, abgesehen von seinem rührseligen oder sensationellen Charakter, in der Regel nicht innerhalb der Grenzen der Pantomime hält, und dass auch die Form der Darstellung nicht immer streng pantomimisch ist. Solange man bei einer Pantomime oder bei der kinematographischen Reproduktion einer solchen das Wort vermisst, haben wir es nicht mit einer echten Pantomime, haben wir es überhaupt nicht mit reiner Kunst zu tun. Man müsste noch mehr als bisher darauf sehen, dass nur solche dramatische Handlungen für den Kino bearbeitet würden, bei denen der Inhalt auch ohne Hinzutritt des Wortes vollkommen klar gemacht werden könnte. Und wenn der bisher so vernachlässigten Pantomime durch den Kinematographen neues Leben zugeführt würde, so wäre das auch in künstlerischer Beziehung nur zu begrüssen.
Auf diesem Wege könnte auch das Komische oder Groteske das ja nicht notwendig roh und gemein zu sein braucht, zum Teil wieder in den Kinematographen eingeführt werden, zumal da ihm durch den Hinzutritt der Musik ein besonderer Reiz verliehen werden könnte, der im Kino in einer dem Inhalt vollkommen adäquaten Weise zur Wirkung zu bringen wäre. Auf die Bedeutung des Trickfilms habe ich schon (S. 19 [s. Verweis &3]) hingewiesen. Besonders aber wäre das Märchen ein gutes Stoffgebiet für die Pantomime des Kinematographen. Denn mit dem Inhalt des Volksmärchens sind die meisten Menschen vertraut. Soweit das nicht der Fall ist, könnte leicht durch vorherige Verlesung des Textes daran erinnert werden. Für Kindervorstellungen wird das pantomimische Märchen immer die klassische Kunstform sein.
Verehrte Damen und Herren
Sie haben sich hoffentlich durch diese Übersicht überzeugt, dass uns die Unterdrückung des Kinematographen völlig fern liegt, dass dieser schönen Erfindung vielmehr auch nach der Ausmerzung der Schundfilms noch eine Menge von Möglichkeiten bleiben, die ihr eine sichere Existenz und eine grossartige Entwicklung verbürgen. Es handelt sich hier, wie nicht oft genug wiederholt werden kann, nicht um einen Kampf gegen den Kinematographen überhaupt, sondern um eine Kritik seiner jetzigen Handhabung. Die Aufgabe besteht darin, ihn, der die schönsten Entwicklungsmöglichkeiten in sich birgt, aber leider in falsche Hände geraten, d. h. zu einem materiellen Geldunternehmen gemacht worden ist, der Kultur wieder zu gewinnen, ihn von einem Volksverdummungsmittel wieder zu einem Volkserziehungsmittel zu machen, ihm den Charakter eines wirklich guten und feinen Volksunterhaltungsmittels zu geben. Daran sollten alle mitarbeiten, die sich für Volkswohlfahrt, für künstlerische Erziehung, für die Erhaltung guter alter Sitten, kurz für alles das interessieren, was heutzutage den Besten des Volkes am Herzen liegt.
Nun ist es freilich sicher, dass bei der Reform des Kinematographen, die wie anstreben, manche Kinematographenbesitzer und Filmfabrikanten zuerst finanziellen Schaden erleiden würden. Zum mindesten dadurch, dass schon heute sehr viel Kapital in den Schundfilms steckt, das mit der gesetzlichen Ausmerzung derselben vernichtet werden würde. Und es wird auch unter den geschäftlich Uninteressierten nicht an solchen fehlen, die, erfüllt von dem grossen Gerechtigkeitssinn, der uns Deutsche nun einmal auszeichnet, und verblendet durch die bekannten Phrasen vom "freien Spiel der Kräfte", den Staat daran hindern möchten, Gesetze oder Polizeiverordnungen zu erlassen, durch die ein bestimmter, im Volke vertretener Erwerbszweig, wenn auch wahrscheinlich nur für kurze Zeit, pekuniär geschädigt werden könnte. Ihnen gegenüber muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die Filmindustrie zu Dreivierteln in den Händen des Auslandes liegt, dass also ein grosser Teil des Geldes, das bei uns der kleine Mann in den Kino trägt, nach Frankreich, Amerika, England und Italien wandert. Wir haben aber nicht das geringste Interesse daran, die Taschen der auswärtigen Aktionäre und der grossen Patentbesitzer, der Herren Edison usw. mit den sauer verdienten Groschen unserer Arbeiter und Kleinbürger zu füllen. Abgesehen von diesem wirtschaftlichen Gesichtspunkt handelt es sich aber auch um ein Ideales, nämlich, um das geistige Wohl, um die Kultur und Gesittung des deutschen Volkes. Man sollte endlich einmal einsehen, dass Zivilisation und Kultur nicht identisch sind, dass technische Erfindungen, die dem Fortschritt dienen, unter Umständen die geistige Kultur schädigen können, und dass Zivilisation nur dann erwünscht und berechtigt ist, wenn sie der Kultur Vorschub leistet. Und was heisst denn hier ein gerechtes Abwägen der Interessen? Jahrelang haben die Kinointeressenten ungestraft auf das ethische Gefühl des Volkes und seine ästhetische Bildung loswüsten dürfen. Es ist wohl nicht zuviel verlangt, wenn man ihnen jetzt auch einige Opfer zumutet. Und in Fragen des Staatswohls hat doch von jeher der Grundsatz gegolten, dass die Interessen der Einzelnen sich denen der Gesamtheit unterzuordnen haben. Denn der Staat ist keine Institution des Kapitalismus, die alles zu fördern hat, was dem Gelderwerb dient und dadurch die Steuerkraft der Bürger erhöht, sondern ein Kulturfaktor, dessen Aufgabe darin besteht, das Volk geistig zu heben. Auf der einen Seite stehen die Geldinteressen einzelner, die wohl schon bisher genug verdient haben, auf der anderen die moralische Tüchtigkeit und die ästhetische Gesundheit des ganzen Volkes. Da sollte, wie wir meinen, die Entscheidung nicht allzu schwer fallen.
Nach diesen beiden Reden nahm die Versammlung, die aus etwa 4-500 Bürgern und Bürgerinnen Tübingens bestand, eine Erklärung an, die an das Kgl. Württembergische Staatsministerium und die Landstände gerichtet war und eine gesetzliche Regelung des Kinematographenwesens in dem hier vertretenen Sinne, besonders ein Verbot der Schundfilms und die Einrichtung einer zentralen Zensurbehörde zum Schnee der Jugend forderte. Obwohl der Vorsitzende zur Diskussion einlud, erfolgte kein Widerspruch aus der Versammlung, wohl aber war die einstimmige Annahme der Erklärung von starkem Beifall begleitet. Da die Versammlung vom Rektor der Universität, den Rektoren sämtlicher Tübinger Schulen und von mehreren der Volkswohlfahrt dienenden Vereinen einberufen war, darf man annehmen, dass die hier vorgetragenen Forderungen den Anschauungen der meisten Gebildeten unserer Stadt entsprechen. Wie verlautet, plant die Kgl. Württembergische Regierung die Einbringung eines Kinematographengesetzes schon für die nächste Zeit. Möge seine Fassung den hier ausgesprochenen Wünschen Rechnung tragen
Nachtrag
Seitdem diese Vorträge gehalten worden sind, ist die Kinematographenfrage in Württemberg um einen Schritt weiter gekommen, von dem man aber leider sagen muss, dass er eher ein Rückschritt ist.
Am 27. Juni d. J. hat die Zweite Kammer über die Frage beraten. Obwohl von den Abgeordneten aller Parteien Gedanken vorgebracht wurden, die mit den unsrigen ziemlich genau übereinstimmen, ist man doch nur so weit gegangen, die Regierung zu ersuchen, dass sie im Bundesrat auf die Einbeziehung des Kinematographen in die Reichsgewerbeordnung (§ 33 a) hinwirke, und dass sie eine Ergänzung des württembergischen Polizeistrafrechts in Erwägung ziehe, besonders in der Richtung, dass der Besuch der Lichtspieltheater durch jugendliche Personen eingeschränkt werde. Dass dies bei weitem nicht genügt, braucht nach dem Gesagten wohl nicht mehr hervorgehoben zu werden.
Auf S. 34 [s. Verweis &4] ist schon erwähnt worden, dass sich die Polizeiverwaltung der Stadt Stuttgart neuerdings mit grosser Energie der Einschränkung des Kinematographenrepertoires angenommen hat. Es ist ein Verdienst des aus Bayern zur Reform der Stuttgarter Polizei berufenen Polizeiamtmannes Dr. Bittinger, in dieser Beziehung bestimmte Vorschläge gemacht und dabei immer wieder betont zu haben, dass ohne gesetzliche und polizeiliche Massnahmen den Gefahren des jetzigen Betriebes nicht zu begegnen sei. Leider haben seine Bemühungen bisher bei den bürgerlichen Kollegien nicht das gewünschte Entgegenkommen gefunden. Diese haben vielmehr am 4. Juli d. J. eine Forderung des Polizeiamtmannes, die die Gründung einer zentralisierten polizeilichen Filmprüfungsanstalt ermöglichen sollte, abgelehnt. Da hiermit die Ausführung eines Ministerialerlasses unmöglich gemacht worden ist, hat der Polizeiamtmann am 5. Juli in den Zeitungen erklären lassen, dass die bisherige, übrigens seiner eigenen Meinung nach unzureichende Kontrolle eingestellt worden sei, dass also die in Stuttgart und damit auch im übrigen Württemberg vorgeführten Films von jetzt an nicht mehr kontrolliert würden. Mit vollem Recht ist diese merkwürdige Tatsache vom Polizeiamt bekannt gemacht worden, damit das Publikum gewarnt sei. Darüber sind wieder die bürgerlichen Kollegien sehr böse gewesen, da man zwar gern verkehrte Beschlüsse fassen will, aber nicht liebt, sie in weiteren Kreisen bekannt werden zu lassen.
Die hierdurch erlangte völlige Freiheit war aber selbst den Kinobesitzern zu viel. Denn sie haben beschlossen, sich freiwillig einer Zensur zu unterwerfen, indem sie vom 13. Juli d. J. an nur solche Films zur Vorführung bringen wollen, welche von dem Polizeipräsidium Berlin oder der bayerischen Landeszensur in München geprüft und zur Vorführung zugelassen sind. Ausserdem wollen sie Personen unter 16 Jahren, auch in Begleitung Erwachsener, den Besuch ihrer Vorstellungen nicht mehr gestatten, endlich keinerlei Reklame durch Buntdruckplalate mehr machen. Die strenge Ausschliessung der Kinder verbürgt natürlich nicht die grössere Strenge in der Auswahl der Films, eher könnte man vielmehr das Gegenteil vermuten.
Jedenfalls haben diese Stuttgarter Vorgänge wieder zur Genüge gezeigt, dass ohne gesetzliches Verbot der Schundfilms nichts erreicht werden kann.
Literatur [s. Verweis &2]
Ernst Schultze: Der Kinematograph als Bildungsmittel. Halle 1911.
W. Conradt: Kirche und Kinematograph. Berlin 1910.
H. Lehmann: Die Kinematographie, ihre Grundlagen und ihre Anwendungen. Leipzig 1911.
A. Hellwig: Schundfilms. Halle 1911
L. Laquer: Über die Schädlichkeit kinematographischer Veranstaltungen für die Psyche des Kindesalters. Ärztl. Sachverständ.- Zeitung 1911.
A. Hellwig: Die Schädlichkeit von Schundfilms für die kindliche Psyche. Ärztl. Sachverständ.-Zeitung 1911.
A. Sellmann: Der Kinematograph als Volkserzieher? Langensalza 1912.
M. Brethfeld: Kinematograph und Schuljugend. Korrespondenz des Dürerbundes.
Dölker: Über die Kinematographenfrage. Mitteilungen des Landesverbandes für Jugendfürsorge in Württemberg 1912. Nr. 9.
K. W. Wolf-Czapek: Die Kinematographie. Berlin, 2. Aufl. 1911.
R. Gaupp: Die gesundheitlichen Gefahren des Kinematographen für die Jugend. Schwäb. Merkur. 11. Mai 1912. Nr. 217.
K. Lange: Die "Kunst" des Kinematographen. Korrespondenz des Dürerbunds. 1912
Ausserdem zahlreiche kürzere Zeitungsartikel in vielen deutschen Zeitungen und Zeitschriften, zuletzt in der Frankfurter Zeitung vom 30. und 31. Mai dieses Jahres.
Remark
[Hier im Text sind Verweise im Artikel "&" und Nummer. ] [Nach den beiden Vorträgen ein Abschlusswort des Bundes - ohne Autor - und ein Nachtrag. Zum Abschluss eine Literaturliste.]
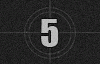
Please enable Javascript
This site only works with Javascript enabled. Please check your browser settings and then reload this page. Thank you.